

"Berliner Morgenpost", 4.6.1992




In Anstaltskleidung und mit Handschellen demonstriert ein ehemaliger Häftling 2004 die Beförderung im „Grotewohl-Express“ (© picture-alliance / dpa-Bildarchiv, Foto: Wolfgang Kumm)




"Berliner Morgenpost", 4.6.1992

"Berliner Morgenpost", 4.6.1992
Mitte: "B.Z.", 3.6. 1992
Die späteren Merkelschen "Fachkräfte" zertrümmerten schon 1992 die Einrichtung ihres Wohnheimes in Luckenwalde.
Rechts: "B.Z.", 2.6.1992


Gedenken 17. Juni 2020 am Mahnmal "Weiße Kreuze". Vereinigung 17. Juni 1953 e.V., AfD und CDU.






Die Kränze der Vereinigung 17. Juni 1953 e.V. bezahlte Gustav Rust vom Spendengeld.




Artikel aus "Berliner Zeitung" vom 1.6. 1992



Berliner Kurier, 29.05.1992

Tagesspiegel, 29.05.1992

BILD, 29.05.1992

Tagesspiegel, 25.05.1992


Morgenpost, 29.05.1992

B.Z., 25.5.1992
Artikel links: Bild, 25.5.1992

Berliner Kurier, 30.05.1992

B.Z., 29.05.1992

Frankfurter Rundschau, 29.05.1992

Tagesspiegel, 27.05.1992

Morgenpost, 27.05.1992

Morgenpost, 27.05.1992

Potsdamer Neueste Nachrichten, 27.05.1992

B.Z., 25.05.1992


Berliner Zeitung, 29.05.1992

B.Z., 25.05.1992

B.Z., 25.05.1992


Artikel links und oben:
Bild, 25.05.1992


Frankfurter Rundschau, 25.05.1992

Norwegischer Frauenchor singt 2019 ein Lied am Mahnmal.



Kranz zum Volkstrauertag 2020
Der 17. Juni 2020 in Chemnitz - Gedenken der Vereinigung der Opfer des Stalinismus e.V. (VOS)

.Das Foto zeigt 11 Kameraden der VOS - Sachsen, Bezirksgruppe Chemnitz. Von links Nr.1 unbekannt aber VOS,
Nr. 2 Altmann VOS, Nr. 3 unbekannt - Frau von Nr.1, Nr. 4 Dr.Steffi Lehmann aktiv Kaßberg - Gefängnis, Nr. 5 Sabine Popp,
Nr. 6 Kamerad VOS Aue, Nr. 7 Jörg Petzold (Stasi - Haft 1965 Kaßberg - Gefängnis), Nr. 8 W.Raubold-Ehemann in Haft,
Nr. 9 R.Steinbach, 92 Jahre alt 7 Jahre Gulag. Nr. 10 H.Bemme, 92 Jahre alt 4 Jahre Gulag und Nr.11 ist Holker Thierfeld BStU Chemnitz, Leiter der Gruppe.


Gesche Würfel vom Künstlerhaus Bethanien interviewte mich Anfang Dezember 2021 und fotografierte mich.
Aufgrund mehrerer Schlaganfälle in der Wohnung rief ich am 11.12.2022 die Feuerwehr und befinde mich inzwischen im Seniorenpflegeheim DOMICIL, Frobenstraße 79, 12249 Berlin-Lankwitz.

Die Kameraden Carl-Wolfgang Holzapfel, Brigitte Bielke mit Sohn Ralf halfen meinem Sohn Olaf (rechts) bei der Auflösung meiner Wohnung.
Rechts:
Kamerad Bodo Walther besuchte mich.



Bild oben:
Adam Lauks besucht mich.
Links:
Kamerad Karsten Kasperzack besucht mich am 23.7.22.


Links:
Vom Spendengeld bestellte ich bei Benno Kierey, Steglitzer Damm, diesen Kranz zum Gedenken an die Opfer von Schandmauer und Stacheldraht, den Benno Kierey anlieferte.
Rechts:
Vor den beiden Kränzen der Vereinigung 17. Juni 1953. Der linke Kranz hängt anlässlich des 50. Todestages von Peter Fechter am 17. August. Die beiden Aufnahmen machte Tatjana Sternenberg.

Beide Kränze der Vereinigung 17. Juni 1953. Quelle: Berliner Zeitung. Foto: dpa/Fabian Sommer.
Der dazu gehörende Artikel stammt vom 12. August 2022.

Olaf, mein Sohn aus erster Ehe, besucht mich.

Kamerad Karsten Kasperzack schiebt mich in der Kälte zum Café an der Ecke am 4.2.23.

Kamerad RA Bodo Walther besucht mich im Januar 2023.
Quelle: Ärzteblatt
THEMEN DER ZEIT
Traumatisierung politischer Gefangener in der DDR: Schweres Erbe
PP 8, Ausgabe September 2009, Seite 406 Sonnenmoser, Marion
Die Wunden sind noch lange nicht verheilt: Schikanen, wie Verhöre zur Nachtzeit, Isolierung und Informationssperren für Häftlinge waren keine Seltenheit – die politischen Gefangenen der DDR leiden bis heute an den Folgen der Haftumstände.
Nach Schätzungen des Bundesministeriums für Justiz waren rund 200 000 Menschen in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1949 bis 1989 aus politischen Gründen inhaftiert.
Nach offiziellen sowjetischen Angaben waren außerdem zwischen 1945 und 1949 rund 123 000 Männer und Frauen in der Sowjetischen Besatzungszone in Speziallagern interniert. Bei diesen Gefangenen handelte es sich vor allem um Nazifunktionäre aus dem einfachen und mittleren Dienst, später auch um ehemalige Mitglieder kommunistischer und linkssozialistischer Gruppen und um Sozialdemokraten. „Schlaf- und Essensentzug, tage- und nächtelange Dauerverhöre, Einzelhaft, Steh- und Wasserkarzer und physische Misshandlungen waren während der Untersuchungshaft die Regel“, weiß die Berliner Psychologin Dr. Doris Denis. Die überbelegten Baracken, in denen die Lagerhäftlinge untergebracht wurden, waren verwahrlost, voller Ungeziefer und nur spärlich beheizt. Auch die mangelhafte Verpflegung, die den Kalorienbedarf eines erwachsenen Menschen nicht annähernd deckte, zehrte an der Gesundheit der Inhaftierten. Erkrankungen wurden gar nicht oder nur unzureichend medizinisch behandelt. Ehemalige Lagerhäftlinge, und durchaus nicht nur weibliche, berichteten von Vergewaltigungen durch die Aufseher.
Missliebige Äußerungen galten als Staatsverleumdung
Nach den Definitionen der Vereinten Nationen entsprachen die damaligen Haftbedingungen und Verhörmethoden psychologischer und häufig auch körperlicher Folter. Bis 1949 verstarb etwa ein Drittel der Häftlinge unter den extremen Bedingungen. In den ersten Jahren nach der Gründung der DDR änderten sich die Haftbedingungen nur geringfügig und blieben auch nach dem Aufstand am 17. Juni 1953 für die Häftlinge äußerst belastend.
In den 50er- und 60er-Jahren wurden vorrangig Personen verhaftet, die sich nicht konform mit den gesellschaftlichen Zielen und der Verstaatlichungspolitik der DDR zeigten. In den Jahren nach dem Mauerbau bis zur politischen Wende 1989 stellten unter den politischen Häftlingen der DDR die sogenannten Republikflüchtlinge die größte Gruppe dar (40 bis 50 Prozent). In den 80er-Jahren inhaftierte man in der DDR darüber hinaus zunehmend Personen, die öffentlich für ihren Ausreiseantrag eingetreten waren (15 bis 25 Prozent). Missliebige Äußerungen galten als „staatsfeindliche Hetze“, „Staatsverleumdung“ oder „öffentliche Herabwürdigung“ (zehn bis 20 Prozent). Dem Regime nicht genehme Kontakte oder Informationsweitergaben in die BRD wurden als „Verbindungsaufnahme“ beziehungsweise „Nachrichtenübermittlung“ verfolgt (ein bis fünf Prozent).
Die Verhaftung von DDR-Flüchtlingen geschah in der Regel in flagranti, das heißt am jeweiligen Grenzabschnitt des Fluchtversuchs. Regelmäßig setzten die DDR-Grenztruppen dabei Schusswaffen ein. Eine große Anzahl von DDR-Flüchtlingen wurde schon im Vorfeld ihres eigentlichen Versuchs verhaftet, teils auf Fahrten zu Grenzabschnitten, teils in der Vorbereitungsphase zu Hause. Der Zeitpunkt der meisten Verhaftungen war für die Betroffenen überraschend.
Bis zum Ende der DDR waren die Haftumstände belastend
Anschließend wurden die meisten Betroffenen ohne Nennung eines Ziels in die Untersuchungshaftanstalten des Ministeriums für Staatssicherheit gebracht und blieben dort Wochen bis viele Monate.
Mit den Bemühungen der DDR um internationale Anerkennung verbesserten sich die Bedingungen in den Haftanstalten zu Beginn der 70er-Jahre. Dennoch waren die Haftumstände auch in den 70er- und 80er-Jahren bis zum Ende der DDR äußerst restriktiv und für die Häftlinge sehr belastend. Die Methoden der Einschüchterung und Entehrung wurden weniger massiv, dafür subtiler. Politische Inhaftierung in diesen Jahren ging mit einem hohen Maß an Unvorhersehbarkeit und Unsicherheit einher. In den Verhören wurden die Häftlinge gezielt desinformiert und getäuscht. Häufig wechselten ein freundlicher und ein bedrohlicher Vernehmer, um die Inhaftierten zu verunsichern. Es wurden ihnen Prügel, der Entzug von Besuchs- und Schreiberlaubnis, die unbefristete Verlängerung der Untersuchungshaft oder die Benachteiligung und Inhaftierung von Angehörigen angedroht. Auch Todesdrohungen gegen die Inhaftierten und deren Familien gab es. Häufig deuteten die Verhörer nur vage an, dass der Gefangene das Gefängnis nie mehr oder als anderer Mensch verlassen werde, außerdem enthielten sie ihm Informationen über den weiteren Verlauf der Inhaftierung vor; das zersetzte die Gefangenen oft mehr als konkrete Strafmaßnahmen. Die Häftlinge wurden mit Nummern angeredet, die der Lage ihrer Pritschen in den Zellen entsprachen. Nachts wurde das Licht in regelmäßigen Abständen an- und ausgeschaltet und dabei die vorgeschriebene Schlafposition (auf dem Rücken liegend mit unbedecktem, nach oben gerichtetem Gesicht) überprüft. Oft musste völlig unerwartet die Zelle oder sogar das Gefängnis gewechselt werden. Die Inhaftierten blieben im Ungewissen darüber, welche Schikanen sie noch erwarteten und was mit ihren Angehörigen passierte. Zensur von Briefen und Kontaktsperre machten es unmöglich, Angaben der Verhörer zu überprüfen und verlässliche Informationen über das Schicksal von Familienangehörigen und Freunden zu erhalten. Üblich während der Untersuchungshaft waren außerdem Nachtverhöre, Schlafentzug, Isolationshaft und Dunkelzelle sowie belastende Haftbedingungen, zu denen unter anderem Arrestierungen und Isolationshaft für Tage, Wochen, Monate und Jahre (das heißt absolute Kontaktsperre nach draußen, keinerlei Beschäftigungsmöglichkeiten, Liegen auf der Pritsche nur nachts, keine Selbstgespräche, Dauerbeaufsichtigung, maximal fünf Schritte gehen in jede Richtung), das Zusammengesperrtsein mit Schwerkriminellen, Kontaktsperren zu Angehörigen sowie Zwangsarbeitsbedingungen bei fehlendem Arbeitsschutz zählten.
54 ehemalige politische Gefangene, die zwischen 1945 und 1971 inhaftiert und im Rahmen einer Studie befragt worden waren, erlebten vor allem die schlechte Unterbringung und Versorgung sowie psychische Folter als belastend. Sie berichteten von Nachtverhören, Schlafentzug, ständigem Laufenmüssen in abwechselnd eiskalter und heißer Zelle, Einzelhaft, Steh- und Wasserkarzer, Dunkelzellen und von Scheinhinrichtungen des Gefangenen selbst oder von Mitgefangenen. Auch körperliche Misshandlungen waren an der Tagesordnung, etwa Ausschlagen von Zähnen, Schläge und Elektroschocks. Darüber hinaus hatten die Befragten unter Schikanen von Wärtern und Verhörern zu leiden, wie Blenden bei Verhören, demonstrativem Essen vor dem hungernden Häftling, Anschreien, Aufsetzen von Dunkelbrillen, stundenlanges Stehen, Ansprache als Nummer, Entkleiden vor dem Wachpersonal, Duschen unter Beobachtung, Scheren der Haare und Verbot, die Toilette zu benutzen. Weitere Belastungen entstanden durch schlechte Arbeitsbedingungen, Kontaktsperre und Zensur, Zellenüberwachung, Bespitzelung, Drohung mit Repressalien sowie Vergewaltigungen und Gewaltanwendung.
Die Staatssicherheit ging unberechenbar vor
Im Zuge der Ratifizierung des UNO- Paktes über die bürgerlichen und politischen Rechte im November 1973 schien die politische Toleranzbreite in der DDR größer zu werden. Es konnten offizielle Ausreiseanträge gestellt werden, und die Strafmaße in politischen Prozessen fielen milder aus als in den Jahren davor. Hinter diesen scheinbaren Verbesserungen verbargen sich jedoch verdeckte Methoden der Verfolgung. Die Staatssicherheit ging unberechenbar vor und wollte Exempel statuieren. Politisch unliebsame Personen wurden nicht mehr jahrelang inhaftiert, waren aber neben häufigen und unvorhersehbaren Verhören und kürzeren Gefängnisstrafen intensiven Bespitzelungen und sogenannten Zersetzungsmaßnahmen ausgesetzt. Sie reichten von Telefonterror, massenhaften Warenbestellungen im Namen des Betroffenen, Berufsverbot und gezieltem Streuen von Gerüchten bis zu diversen Alltagsbehinderungen wie zum Beispiel dem ständigen Beschädigen des für den Arbeitsweg benötigten Fahrzeugs. Nicht selten drangen Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes mit Nachschlüsseln in die Wohnung der Betreffenden ein, veränderten oder stahlen einzelne Gegenstände und brachten Abhörgeräte an. Diese Verfolgungspraxis zielte auf Verunsicherung, Isolation und Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten des Betroffenen und schuf in vielen Fällen eine Atmosphäre des Miss-trauens, der Ohnmacht und der Angst. Die Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit sowie das Auseinanderbrechen von Familien und Freundeskreisen waren dabei häufige soziale Folgen, die durchaus von der Staatssicherheit beabsichtigt waren. „Der Anstieg der Zahl der Mitarbeiter im Ministerium für Staatssicherheit von 52 000 im Jahr 1973 auf 83 000 im Jahr 1983 macht deutlich, dass es sich bei diesen Zersetzungsmaßnahmen nicht um zufällige, sondern um gut geplante und mit hohem Personaleinsatz durchgeführte Repressionsmaßnahmen handelte“, so Denis.
Ehemalige Inhaftierte leiden unter den Langzeitfolgen
Viele ehemalige Bespitzelte und Inhaftierte litten jahrzehntelang und leiden selbst heute noch unter den Langzeitfolgen von Verfolgung und Haft. Das ergab zum Beispiel eine Studie an der HU Berlin, bei der Psychologen Ende der 90er-Jahre 384 ehemals politisch Inhaftierte der DDR befragten. 62 Prozent gaben aktuelle psychische Störungen aufgrund der Haft an, vor allem Schlafstörungen und Ängste. 40 Prozent waren während der Haft misshandelt worden, und 17 Prozent berichteten von Lebensgefahr in der Verhaftungssituation. Die erlebte Lebensgefahr erhöhte das Risiko psychischer Beschwerden um das 1,9-fache, während Lebensgefahr und Misshandlungen es um das 2,8-fache erhöhten. Eine Studie, die an der TU Dresden durchgeführt wurde, ergab, dass jeder Dritte von 146 ehemaligen politischen Gefangenen auch noch Mitte der 90er-Jahre unter einer PTBS und komorbiden Störungen wie Ängsten, somatoformen und depressiven Störungen litt. Das äußerte sich laut einer Studie der FU Berlin zum Beispiel in Panikanfällen, Angst vor engen Räumen mit geschlossenen Türen, tiefem Misstrauen gegenüber anderen Menschen (insbesondere Männern), Furcht vor erneuten, negativen Erlebnissen, Hoffnungslosigkeit, Albträumen und quälenden Erinnerungen, die durch Alltagsereignisse ausgelöst wurden. Neuere wissenschaftliche Studien wiesen außerdem eine Vielzahl psychischer Veränderungen nach Extrembelastungen und Traumatisierungen (insbesondere bei länger währenden, wiederholten Traumata) nach, die nicht unter die Diagnose der PTBS gefasst werden können. Es handelt sich dabei um Störungen der Affekt- und Impulsregulation, vor allem um Schwierigkeiten im Umgang mit Wut und Ärger, um dissoziative Symptome, um selbstzerstörerisches und suizidales Verhalten, um Beeinträchtigungen des Identitätsgefühls und um interpersonelle Störungen, wie die exzessive Beschäftigung mit Rachegefühlen, Sozialphobie und Sinnverlust.
Viele, aber längst nicht alle ehemals politisch Gefangenen entwickelten infolge der Haft eine PTBS. Mit den Gründen für die interindividuellen Unterschiede befassten sich Psychologen der Universitäten Oxford und Dresden, indem sie 26 Personen mit einer chronischen PTBS und 26 Nichtbetroffene interviewten. Die Gruppen waren hinsichtlich objektiv erlittener Haftbedingungen oder soziodemografischer Merkmale vergleichbar. Allerdings berichtete die Mehrzahl der PTBS-Betroffenen von Momenten des Sichaufgebens während der Haft, wohingegen Nichtbetroffene eine autonome Geisteshaltung, einen freien, ungebrochenen Willen und eine regimekritischere Haltung bewahren konnten und sich nicht aufgaben. Die Personen mit PTBS fühlten sich gegenüber anderen Menschen stärker entfremdet und hatten den Eindruck, dass die Hafterfahrung zu irreversiblen, negativen Veränderungen ihrer Persönlichkeit und ihres Lebens geführt hatte. Die Wissenschaftler schlossen daraus, dass Gedankenprozesse während der Haft und die Interpretation ihrer Folgen mit chronischer PTBS zusammenhängen. Sie schreiben: „Eine gefestigte politische Überzeugung konnte vor psychischen Folgen von Traumatisierung schützen.“ Mit Resilienzfaktoren bei ehemaligen Häftlingen der DDR beschäftigten sich auch Wissenschaftler der FU Berlin. Sie stellten fest, dass nach der Haft seltener psychische Beschwerden auftraten, wenn die Betroffenen beruflich integriert waren, über viele soziale Kontakte verfügten und der Hafterfahrung positive Einflüsse auf ihr weiteres Leben abgewinnen konnten, wie beispielsweise Reifung, Gewinn an Lebenserfahrung, Menschenkenntnis und Urteilsfähigkeit, Gespür für gefährliche Situationen, Solidarität unter Häftlingen und Veränderungen persönlicher Werte.
Die Opfer des DDR-Regimes kämpften jahrelang für eine Entschädigung. Im September 2007 gestand der Bundestag schließlich 250 Euro Pension solchen politisch Verfolgten zu, die in der DDR mindestens ein halbes Jahr inhaftiert waren. Schätzungsweise 42 000 Betroffene haben Anspruch auf die Entschädigung. Missbrauchsfälle stellen neuerdings jedoch die Opferrente infrage. So nimmt zum Beispiel das Bundesland Brandenburg laut verschiedener Pressemeldungen immer häufiger Bescheide zurück, weil die Pensionsantragsteller für die Staatssicherheit tätig waren. Auch im Bundesland Sachsen versuchten ehemalige Stasimitarbeiter, staatliche Hilfe zu kassieren. Etwa zwei Prozent aller Anträge wurde von Personen mit Stasivergangenheit gestellt, wobei die Dunkelziffer möglicherweise höher liegt.
Es findet keine erfolgreiche Verarbeitung statt
Aber nicht nur der Entschädigungsmissbrauch nährt das wachsende Empfinden von Ungerechtigkeit bei den Stasiopfern. Auch die gesellschaftlichen Umstände, die eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem DDR-Regime und dem Leid der Opfer erschweren, die Möglichkeit, den ehemaligen Peinigern jederzeit zu begegnen sowie die unzureichende Bestrafung der Täter – einige ehemalige Stasimitarbeiter und SED-Mitglieder sind in hohen beruflichen Positionen oder beziehen üppige Renten – tragen nicht gerade zu einer erfolgreichen Verarbeitung des erlittenen Unrechts bei.
Dr. phil. Marion Sonnenmoser
Quelle: rbb-online.de
Trotz Vorstrafe wegen Rechtsbeugung Anwaltszulassung für ehemalige DDR-Staatsanwältin
Nach Recherchen des rbb-Politikmagazins KLARTEXT erhielt eine ehemalige Staatsanwältin der DDR trotz einer Vorstrafe wegen Rechtsbeugung im Jahre 2000 eine Anwaltszulassung in Brandenburg. Ungehindert konnte sie danach noch jahrelang in Cottbus als Rechtsanwältin arbeiten. Vom Rechtsbeuger zum Rechtspfleger - und das in einem Rechtsstaat? Experten sind empört.
Dass ein Rechtsanwalt, der das Gesetz vertritt, selbst eine weiße Weste haben sollte, ist eigentlich selbstverständlich. Eigentlich. Doch in Brandenburg nimmt man es offenbar nicht so genau mit der Integrität von Rechtsanwälten, die auch schon in der DDR-Justiz aktiv waren. Dabei wird die Forderung nach historischer Aufarbeitung immer lauter. Gabi Probst.
Die Juristin Eva-Maria Müller aus Cottbus – hier links im Bild - ist im Jahr 2000 zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden – wegen Rechtsbeugung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung. Der Grund: Hier am Cottbusser Gericht hatte sie als leitende Staatsanwältin bis zum Ende der DDR Ausreisewillige unschuldig ins Gefängnis gebracht.
An „Haftbefehlsanträgen, Haftfortdaueranträgen, Anklageerhebungen, Anträge von Freiheitsstrafen“ usw. habe sie mitgewirkt - so das Urteil - obwohl die Strafbestände Bagatellcharakter hatten. An der Juristischen Fakultät der Humboldt Uni nahm man solche Anklagen unter die Lupe. Für die Experten waren diese Staatsanwälte und Richter Vollstrecker der Staatssicherheit der DDR.
Prof. Rainer Schröder, Juristische Fakultät Humboldt-Universität Berlin
„Die Staatssicherheit und gerade die Abteilung 1 der Staatsanwaltschaften, die wollten diesen Personenkreis wie Feinde ausschalten. Man wandte dazu so ein Art von Feindstrafrecht an und da war so quasi jedes Mittel recht, um diese Leute loszuwerden. Und da dehnte man die Straftatbestände wirklich über das Maß der normalen Auslegung aus.“
KLARTEXT
„Willkürurteile?“
Prof. Rainer Schröder, Juristische Fakultät Humboldt-Universität Berlin
„Willkür.“
Ines Kirsche war so ein Feind. Sie und mit ihr vier andere wollte die Staatsanwältin Müller offenbar loswerden und das nur, weil sie in den Westen wollten. Alle saßen lange im DDR-Gefängnis.
Ines Kirsche
„Man hat es ihr angesehen und gespürt, dass sie es regelrecht genossen hat, als dann unsere Urteilsverkündung kam. Sie hätte auch am liebsten für uns alle die Höchststrafen für uns durchgesetzt, weil wir in ihren Augen ganz, ganz schlimme Feinde waren.“
Die hohen Haftstrafen waren für die Eltern ihres mitangeklagten Freundes Michael Menk unerträglich. Sein Vater, Dieter Menk blieb der Staatsanwältin und dem Richter immer auf den Fersen, seit dem Tag der Gerichtsverhandlung. Und der war für das Ehepaar besonders schlimm.
Renate Menk
„Das war nicht schön. Das war wirklich eine ganz schlimme Zeit.“
Dieter Menk
„Ich bin zu der Staatsanwältin in Cottbus, zu Frau Eva Maria Müller, gegangen und gefragt, ob das im Sinne des Rechtsstaates sein kann, dass man für die Sache einen Menschen drei Jahre und drei Monate verurteilt.“
KLARTEXT
„Was hat sie gesagt?“
Dieter Menk
„'Das müssen Sie uns schon überlassen, wir vertreten den Rechtsstaat und im Namen des Volkes erfolgt die Verurteilung und so ist es geschehen.'“
KLARTEXT
„Wie haben Sie sich da gefühlt?“
Dieter Menk
„Ich habe mich so erniedrigt gefühlt.“
Die ehemalige Staatsanwältin Müller konnte nach der Wende fast 20 Jahre lang hier in Cottbus ungehindert als Rechtsanwältin – bis zu ihrer Rente 2008 – arbeiten, davon viele Jahre trotz ihrer Verurteilung!
Dieter Menk
„Da bin ich noch mal hin. Ich wollte mir einfach mal Luft verschaffen.“
KLARTEXT
„Und was haben Sie ihr gesagt?“
Dieter Menk
„'Sie müssten sich die Augen aus dem Kopf schämen, das Sie solche Schandurteile
gesprochen haben und jetzt als Rechtsanwältin den Rechtsstaat vertreten. Ich würde mich an Ihrer Stelle in Grund und Boden schämen.'“
KLARTEXT
„Was hat Sie darauf gesagt?“
Dieter Menk
„Sie hat gesagt: 'Ich bin jetzt hier Rechtsanwältin und habe mit dieser Sache, die ist abgeschlossen, nichts mehr zu tun.“
Wir fragen die Brandenburger Rechtsanwaltskammer. Seit 2002 hat man hier die Hoheit für Zulassungen und Widerrufe für die Rechtsanwälte in Brandenburg. Davor war das Oberlandesgericht verantwortlich, aber ohne eine gutachterliche Stellungnahme der Kammer ging es auch nicht. Bei Verurteilung dürfe er man eigentlich kein Rechtsanwalt sein, zitiert der Präsident das Gesetz. Wir fragen noch mal nach.
KLARTEXT
„Sie haben gerade gesagt, wenn jemand verurteilt worden ist, dann dürfte er kein Rechtsanwalt sein.“
Klaus Engelmann, Rechtsanwaltskammer Brandenburg
„Nach Paragraf 7 Nummer 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung.“
KLARTEXT
„Wie kann es dann aber passieren, dass diese Frau, ich sage Ihnen, wer es ist - es ist Eva-Maria Müller, war in Cottbus bis 2008 weiter Rechtsanwältin, ist aber rechtskräftig 2000 verurteilt worden zu einem Jahr und zehn Monaten wegen Rechtsbeugung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung. Warum konnte diese Frau, wenn Sie jetzt sagen, das geht gar nicht, trotzdem Rechtsanwältin bleiben? … Sie haben gesagt, wenn jemand verurteilt worden ist und jetzt frage ich, ich kenne jemanden der verurteilt worden ist, und der ist trotzdem Rechtsanwalt geblieben. Was ist daran so schlimm? … Wollen Sie jetzt gar nichts mehr sagen?“
Prof. Rainer Schröder, Juristische Fakultät Humboldt-Universität Berlin
„Das spricht dem Begriff aus der Bundesrechtsanwaltsordnung Hohn. Nach der Bundesrechtsordnung sind Rechtsanwälte auch Organe der Rechtspflege und das kann nach meinem Verständnis niemand sein, der gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und oder gegen Strafgesetze so verstoßen hat.“
Und was sagt Eva Maria Müller selbst, hat sie ein schlechtes Gewissen? Weit gefehlt.
Eva Maria Müller
„Da können Sie sich gleich von mir verabschieden. Auf Wiedersehen.“
KLARTEXT
„Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Sie sind doch auch verurteilt worden, nicht wahr?“
Doch sie war nicht allein verantwortlich.
In diesem Rechtsanwaltsbüro arbeitet heute noch der Richter, der die Anklagen von Staatsanwältin Müller mit seinem Urteil besiegelt hatte. Gleich nach der Wende wurde er zunächst sogar Direktor des Gerichts in Finsterwalde – nur 30 Kilometer von Cottbus. Es sind Dieter Menk und seine Frau, die damals an alle Behörden schreiben und wegen dessen Vergangenheit seine Absetzung fordern.
Dieter Menk
„Ich war zum wiederholten Male am Boden zerstört. Ich wusste nicht mehr, was hinten und vorne ist, was soll ich noch als Recht empfinden? Wusste ich nicht!“
Richter Czerwiatiuk entzog sich danach dreist sich mit einer zeitweiligen Flucht ins Ausland seiner Hauptverhandlung und einer Verurteilung – bis die Taten verjährt waren. Heute arbeitet er unbehelligt als Rechtsanwalt in Cottbus.
KLARTEXT
„Ich frag ja auch Sie, wie Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren können.“
Czerwiatiuk
„Ich kann es und andere können es auch.“
KLARTEXT
„Sie können es, obwohl sie die Leute ins Gefängnis gebracht haben?“
Czerwiatiuk
„Ja."
KLARTEXT
„Sehen Sie das noch als rechtens, dass Sie die Leute damals ins Gefängnis gebracht haben?“
Czerwiatiuk
„Das ist eine Kanzlei, würden Sie bitte meine Räume verlassen.“
Sie brachten DDR-Bürger wie Ines Kirsche und Michael Menk ins Gefängnis, weil sie in einem freiheitlich-demokratischen Land, in einem Rechtsstaat, leben wollten – so wie sie es heute tun. Und was macht der Rechtsstaat? Er macht die Täter wieder zu Organen der Rechtspflege, zu Rechtsanwälten.
Prof. Rainer Schröder, Juristische Fakultät Humboldt-Universität Berlin
„Ich bin der Auffassung, dass das ein Verstoß gegen rechtsstaatliche Prinzipien ist. Es fehlte offenbar der Wille, diese Fragen politisch aufzugreifen und ich halte das für einen Skandal.“
Der besorgte Vater Dieter Menk hat vor einigen Wochen die Unrechtsgeschichte an den Justizminister in Brandenburg geschrieben. Er hat noch keine Antwort. Und auch für uns hat der Minister keine Zeit für ein Interview.
Autorin: Gabi Probst
Richter signalisieren bei der Auftragsvergabe von Gutachten, welche Ergebnisse sie erwarten
Quelle: SPIEGEL, 30.03.2014
Jeder vierte Gutachter aus dem medizinischen oder psychologischen Bereich hat in Bayern sogenannte Tendenz-Signale von der Justiz erhalten. Das bedeutet, Richter geben bei der Auftragsvergabe einen Hinweis, welches Ergebnis erwartet wird. Bei Psychologen ist der Anteil derer, die "in Einzelfällen" oder "häufig" solche Signale bekommen haben, noch wesentlich höher als bei Medizinern: Fast jeder zweite psychologische Sachverständige hat offenbar solche Erfahrungen gemacht. Das ergibt eine Studie, deren Ergebnisse in der Fachzeitschrift "Der Sachverständige" im Beck-Verlag Anfang April veröffentlicht werden. Die Autoren haben dazu vergangenes Jahr 548 Gutachter aus Bayern befragt. Jeder dritte psychiatrische und jeder zweite psychologische Gutachter bezieht demnach mehr als 50 Prozent seiner Einnahmen aus Gerichtsgutachten. Daher gebe es eine wirtschaftliche Abhängigkeit von den Aufträgen der Justiz, was die geforderte Neutralität gefährde. Die Autoren empfehlen unter anderem, Gutachter künftig per Los auszuwählen und solche Aufträge nur noch schriftlich zu vergeben, mit Kopie an alle Verfahrensbeteiligten. Mündliche Absprachen zwischen Richtern und Gutachtern sollten zudem verboten werden.
Zeitzeuge des Widerstands gegen Stalin"Todesstrafe! Mir blieb die Luft weg."
Vier Jugendliche in der DDR beschimpften Stalin 1949 über einen selbst gebastelten Piratensender als Massenmörder. Es folgte eine gnadenlose Jagd. Jörn-Ulrich Brödel ist der Einzige, der noch davon berichten kann. Von Christoph Gunkel 09.01.2017
Das erste Urteil: Todesstrafe. Das zweite: Todesstrafe. Das dritte: Todesstrafe.
"Mir blieb die Luft weg", erinnert sich Jörn-Ulrich Brödel und die Fassungslosigkeit lässt seine Stimme noch Jahrzehnte später beben. "Der erste tot, der zweite tot, der dritte tot." Brödel hat mit den Fingern mitgezählt, jetzt verharrt seine Hand hilflos in der Luft. "Ich habe gedacht: Das geht jetzt so weiter." 14. September 1950, Urteilsverkündung gegen 15 Angeklagte vor dem sowjetischen Militärtribunal in Weimar. Alles war perfekt arrangiert am Ende dieses Willkürprozesses ohne Verteidiger. "Wir wurden streng darauf hingewiesen, auf welchem Platz in den beiden Stuhlreihen wir zu sitzen hatten", erzählt Brödel. Damals wunderte er sich. Später verstand er: "Die Urteile standen schon vorher fest."
Wer vorne saß, hatte schlechte Karten. Brödel saß auf dem sechsten Platz in der ersten Reihe. Nur zwei Stühle neben ihm war soeben sein Freund Hans-Joachim Näther zum Tode verurteilt worden. Dessen Gesichtsausdruck vergaß er nie: "Achim grinste leise vor sich hin. Als ob er sagen würde: Ihr könnt machen, was ihr wollt, ich stehe über euch!"
"Das bin ich den Toten schuldig"
Brödel war nicht so fatalistisch. Starr vor Schock bangte er um sein Leben. Er dachte daran, dass Stalin die Todesstrafe 1947 mit propagandistischem Getöse abgeschafft hatte; die UdSSR wollte sich human geben. Er wusste nicht, dass Stalin die Todesstrafe 1950 heimlich wieder eingeführt hatte. Was war hier los?
Urteil Nummer vier und fünf: je 25 Jahre Arbeitslager. Brödel schöpfte Hoffnung. Offenbar waren die Urteile geordnet. Dann sein Verdikt: ebenfalls 25 Jahre wegen "antisowjetischer Propaganda" und "Bildung einer illegalen Gruppe". Erleichterung. Er hatte überlebt.
Jörn-Ulrich Brödel, 85, ist der letzte Zeitzeuge einer bis heute kaum bekannten Widerstandsgruppe aus dem thüringischen Altenburg. Wenig an diesem schmächtigen, freundlichen Mann erinnert zunächst an einen verwegenen Aufrührer. Wer Brödel in seiner Hamburger Wohnung besucht, atmet deutsche Gemütlichkeit ein. Bierkrüge mit Zinndeckel hängen über der Durchreiche zur Küche; Brödel hat lange bei Holsten gearbeitet. Im Wohnzimmer baumelt ein Planeten-Mobilé von der Decke. Die Wände zieren Fotos der Tochter und von Hunden. Auf dem Boden schnarcht Sina, mit zwölf Hundejahren betagt wie ihr Herrchen.
Sobald Brödel aber von seinem Kampf mit der SED-Diktatur erzählt, klingt er nicht altersmilde. Die Empörung ist geblieben, und er will nicht, dass das Unrecht vergessen wird: "Das bin ich meinen toten Freunden schuldig."
»Das waren Blutrichter« Quelle: SPIEGEL, 06.09.1992, Heft 37/1992
Richter und Staatsanwälte der sogenannten Waldheimer Prozesse, mit denen die SED 1950 die Willfährigkeit der DDR-Justiz prüfte, kommen nun in Leipzig selber vor Gericht. In den Schnellverfahren waren damals ohne Beweisaufnahme zahlreiche Todesurteile gegen Nationalsozialisten gefällt worden. Oft blieb ungeprüft, ob die Angeklagten Haupttäter oder Mitläufer waren.
Wenn Richter vor Gericht stehen, ist das schon etwas Besonderes. Wenn aber Richter vor Gericht stehen, weil sie über Juristenkollegen geurteilt haben, wird der Fall einzigartig.
Demnächst wird ein solches Unikum der Rechtsgeschichte verhandelt. Ein alter Mann aus Halle, Otto Jürgens, 86, muß sich vor dem Ersten Strafsenat des Bezirksgerichts Leipzig verantworten, weil er vor 42 Jahren an den sogenannten Waldheimer Prozessen mitgewirkt hat. Gegen zwei weitere Beteiligte, einen Richter und einen Staatsanwalt, ist Anklage erhoben; ihre Verhandlungsfähigkeit wird geprüft.
Der Prozeß gegen Jürgens, der am 13. Oktober beginnen soll, tastet in die dunkelsten Ecken deutscher Justiz. In Waldheim, einem Städtchen im sächsischen Hügelland nördlich von Chemnitz, sind von April bis Juni 1950 mehr als 3000 Menschen in Schnellverfahren abgeurteilt worden. Den Angeklagten wurden die elementarsten Rechte verweigert: Es gab weder eine Beweisaufnahme noch eine Verteidigung, Entlastungszeugen wurden nicht gehört, die Öffentlichkeit war nur in wenigen Schauprozessen zugelassen.
Verurteilt wurden ehemalige Insassen der sowjetischen Internierungslager Sachsenhausen, Buchenwald und Bautzen, die von der Besatzungsmacht ohne nähere Prüfung als Nazi-Verbrecher eingestuft worden waren. Zur Jahreswende 1949/50 wurden sie den DDR-Behörden unterstellt und ins Waldheimer Gefängnis gebracht. Der ehemalige Soldat Benno Prieß, 64, einer der damals Inhaftierten, erinnert sich: »Wir hatten große Hoffnung auf die Deutschen, aber die waren schlimmer als die Russen.«
Die meisten Waldheimer Häftlinge, darunter Lehrer, Ärzte, Richter und Staatsanwälte, waren eher NS-Mitläufer als Täter. Sie wurden meist zu Strafen von zehn Jahren Zuchthaus und mehr verurteilt. Die häufigsten Vorwürfe lauteten auf »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« und »wesentliche Förderung« des Hitlerregimes.
Klar ist: Nicht alle Verurteilten waren unschuldig, selbst harte Strafen mögen in einigen Fällen gerecht gewesen sein. Doch ebenso klar ist, daß in keinem Fall Recht geschah, die Justiz gab den Angeklagten nicht die geringste Chance. Günter Hertweck, 53, der als sächsischer Generalstaatsanwalt bis Mitte des Jahres die Waldheim-Ermittlungen beaufsichtigt hat, kommt zu dem Schluß: »Das waren Blutrichter.«
Blut floß tatsächlich in der Nacht vom 3. auf den 4. November 1950. Im Minutentakt wurden 24 Todesurteile vollstreckt, beispielsweise gegen den SS-Wachmann Helmut Uhlig und den Gestapo-Denunzianten Paul Coijanovic. Der Henkerslohn für die drei Scharfrichter, die »strengstes Stillschweigen« geloben mußten, betrug laut Quittung 8400 Mark. Die weiteren Kosten für das Hinrichtungskommando wurden penibel aufgeführt: Sie beliefen sich auf 291,94 Mark - etwa für Brötchen, Blutwurst, Fleischsalat und »2 Flaschen Brandwein zu 38,60 Mark«.
Die Akten der Hingerichteten sind im November 1990 in zwei Archivkisten des ehemaligen DDR-Innenministeriums entdeckt worden. Hauptsächlich auf diese Unterlagen stützt der Leipziger Staatsanwalt Dietrich Bauer, 52, jetzt seine Anklagen. Weiteres Belastungsmaterial vermutet Bauer im Nachlaß des Ministeriums für Staatssicherheit, der von der Berliner Stasiakten-Behörde verwaltet wird.
Das Verfahren gegen Richter Jürgens, der in Waldheim Beisitzer einer Großen Strafkammer war, basiert maßgeblich auf einem Todesurteil, das dem SPIEGEL in einer beglaubigten Abschrift vom 6. Juni 1950 vorliegt.
Opfer der Scharfrichter war der Staatsanwalt Heinz Rosenmüller, NSDAP-Mitglied seit 1933. Ihm legte das Gericht, dem Jürgens angehörte, zur Last, er habe während der NS-Zeit »nach eigenen Angaben 15 Anklagen wegen antifaschistischer Äußerungen nach dem Heimtückegesetz entworfen«, dazu »die gleiche Zahl von Verfahren gegen Menschen, die ausländische Sender abhörten«.
Außerdem habe Rosenmüller »aufgrund der Volksschädlingsverordnung in erheblichem Umfang Verfahren durchgezogen«, und »er gibt zu, in diesem Zusammenhang 15 Todesstrafen beantragt zu haben, auf die auch erkannt worden sei«.
Der sachliche Ton verliert sich schnell. Passagenweise ergeht sich das Urteil in Andeutungen: »Diese Fälle gibt der Angeklagte zu. Wieviel mehr sind es tatsächlich gewesen.« Rosenmüller sei »verantwortlich für alle die Menschen, die wegen ihrer politischen Vergehen im Sinne des Nazismus abgestraft wurden« . Er habe damit rechnen müssen, daß sie nach der Strafverbüßung »in ein KZ eingeliefert würden und dort den Tod finden würden«.
SED-Richter Jürgens urteilte über den NS-Staatsanwalt Rosenmüller: _____« Der Angeklagte war als Jurist befähigt, das » _____« Unrechtmäßige seiner Handlung einzusehen, trotzdem hat er » _____« sich für die Begehung der Verbrechen entschieden, womit » _____« er vorsätzlich gehandelt hat. »
Ganz ähnlich argumentiert Staatsanwalt Bauer heute gegen die Waldheim-Juristen. In der Tradition der sich mit sich selbst beschäftigenden Justiz betrachtet er die wissentlich begangene Rechtsbeugung als »Schlüssel« der Anklage.
Durch die Prozesse gegen Jürgens und seine Komplizen wird auch der größte Skandal der westdeutschen Nachkriegsjustiz wieder aktuell. Daß kein einziger NS-Richter oder NS-Staatsanwalt in Westdeutschland rechtskräftig bestraft worden ist, verdankten Hitlers juristische Handlanger dem Richterprivileg: Nur der bewußte Verstoß gegen geltendes Recht kann danach eine Strafe begründen.
Der Bundesgerichtshof (BGH) formulierte 1968 im Verfahren gegen den einzigen angeklagten Richter des NS-Volksgerichtshofs, Hans-Joachim Rehse: _____« Der Richter, der ein Todesurteil fällt, kann sich » _____« dadurch nur dann strafbar machen, wenn er das Recht » _____« beugt. Dies setzt voraus, daß er bewußte und gewollte » _____« Verstöße gegen das Verfahrensrecht oder das sachliche » _____« Recht begeht. »
Je fanatischer also ein Richter den Führerwillen für Recht und Gesetz nahm, desto weniger konnte ihm die Bundesrepublik an Verfehlung nachweisen. Rehse, der als Beisitzer des Volksgerichtshof-Präsidenten Roland Freisler an mindestens 231 Todesurteilen mitgewirkt hatte, starb 1969 vor Abschluß des gegen ihn angestrengten Verfahrens.
Dem möglichen Argument, der Volksgerichtshof sei kein ordentliches Gericht gewesen und seine Juristen könnten daher auch das Richterprivileg nicht für sich in Anspruch nehmen, baute der BGH auch gleich vor: Er bewertete die nationalsozialistische Aburteilungsmaschine, die es auf 5243 Todesurteile brachte, als gewöhnliches »Kollegialgericht«. Jedes seiner Mitglieder sei »unabhängig, gleichberechtigt, nur dem Gesetz unterworfen und seinem Gewissen verantwortlich« gewesen.
Dem Bonner Bundestag blieb es - 17 Jahre später - vorbehalten, den Volksgerichtshof als »Terrorinstrument zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Willkürherrschaft« zu definieren. Bei der Beurteilung der Waldheim-Juristen geht es nun um die Frage: Sind ihre Strafkammern ordentliche Gerichte gewesen oder staatliche Terrorinstrumente?
Die SED, soviel steht fest, führte von Anfang an Regie. Die Dokumente lassen den Schluß zu, daß SED-Chef Walter Ulbricht den Rahmen der Prozesse selbst vorgab oder zumindest über die wesentlichen Abläufe laufend informiert wurde. So teilte ihm die zuständige Abteilung des Zentralsekretariats (ZS) im Mai 1950 mit, »zur Frage der Vollstreckung der Todesurteile« bedürfe es einer Beratung.
Aus einer anderen ZS-Abteilung erging die Weisung an die Justiz, »unter allen Umständen hoch zu verurteilen«. Konkrete Vorgabe: »Urteile unter zehn Jahren dürfen nicht gefällt werden.«
Der Potsdamer Historiker Wolfgang Eisert, 44, hat eine naheliegende Erklärung für die Härte der Verfahren. In ihnen habe sich bei den SED-Funktionären und Juristen eine Art vorauseilender Gehorsam gegenüber der Besatzungsmacht gezeigt. Eisert: »Das Unrecht, das die Sowjets begangen hatten, sollte nicht durch eine plötzliche Milde der Deutschen offenkundig werden.«
Dennoch ließen die Waldheim-Regisseure Unsicherheiten erkennen. Die Hinrichtungen beispielsweise wurden geheimgehalten, auf sämtlichen Totenscheinen ist »Herz- und Kreislaufinsuffizienz« als Todesursache vermerkt.
Als sich der damalige DDR-Justizstaatssekretär Helmut Brandt, Mitglied der Blockpartei CDU, mehr für die Waldheimer Verfahren interessierte, als der SED genehm schien, wurde er kaltgestellt. Kurz darauf wurde Brandt unter dem Vorwand »staatsfeindlicher Arbeit« verurteilt; er verbrachte 14 Jahre im Zuchthaus.
Der Druck auf die Beteiligten war also erheblich. Und doch gab es offenbar Reste von Handlungsfreiheit. So zeigten die Abschlußbeurteilungen der SED über die Richter erhebliche individuelle Unterschiede.
Über Otto Jürgens, wie die meisten Waldheim-Juristen nach dem Krieg in einem Schnellkurs ausgebildet, heißt es etwa, er sei »von der Moral der Arbeiterklasse durchdrungen«. Lobend auch der Vermerk: »Es gab bei ihm keine Diskussion über die Richtigkeit der sowjetischen Protokolle.«
Schon etwas anders liest sich die Beurteilung des zweiten jetzt in Leipzig angeklagten Richters: Bei ihm seien »einige ernste Diskussionen« nötig gewesen, um ihm jeden Zweifel auszutreiben, daß die von den Sowjets gelieferten Kurzprotokolle über die Waldheimer Häftlinge korrekt seien. Der Erfolg blieb nicht aus, die Partei bescheinigte dem Mann, er sei »im Verlauf seiner Tätigkeit politisch gewachsen«.
Am Ende der Waldheimer Prozesse konnte die SED gewiß sein, daß sie ihre Justiz auf Linie gebracht hatte; doch solche Fragen werden im Leipziger Prozeß womöglich gar nicht diskutiert. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Helbig, 44, sieht Probleme mit der Verjährung.
Zwar argumentierten Justizminister in Bund und Ländern, etliche Deliktarten wie zum Beispiel Totschlag an Mauer und Stacheldraht könnten gar nicht verjährt sein. Da sie in der DDR aus politischen Gründen nicht verfolgt wurden, habe die Rechtspflege sozusagen geruht, damit sei auch der Anspruch der Täter auf Verjährung ihrer Taten binnen bestimmter Fristen hinfällig. Dieses Konstrukt stützen die Justizpolitiker auf die geltende Rechtsprechung zu Nazi-Verbrechen.
Doch Helbig äußert Zweifel, »ob man 40 Jahre DDR mit 12 Jahren NS-Zeit vergleichen kann«. So könnte es sein, spekuliert der Richter, daß die Waldheim-Juristen irgendwann auch schon zu DDR-Zeiten hätten belangt werden können, jedenfalls prinzipiell, »vielleicht nach dem Tod Stalins oder Ulbrichts«. Der Vorwurf der Rechtsbeugung wäre dann verjährt.
Bliebe noch die mögliche Aberkennung des Richterprivilegs mit der Begründung, die Waldheim-Strafkammern seien keine ordentlichen Gerichte gewesen. Dann ließen sich die Juristen sofort wegen Mordes anklagen. Doch auch für diesen Fall sieht Helbig »eminente Beweisschwierigkeiten«, denn ein beteiligter Richter brauche jetzt nur zu sagen, er persönlich habe 1950 gegen die Todesurteile gestimmt: »Dann ist der Mordvorwurf weg.«
Es scheint gut möglich, daß auch dieser Versuch, Justizunrecht juristisch aufzuarbeiten, ergebnislos bleibt.
„Warum immer wieder ich?“
Eva-Maria Stege rackerte fünf Jahre in einem sibirischen Arbeitslager/ Vergebens kämpfte sie nach dem Zweiten Weltkrieg als Verfolgte Stalins um Entschädigung: Das „Unrechtsbereinigungsgesetz“ hat sie vergessen ■ ULRIKE HELWERTH
Ein paar Meter weiter nur, und das alles wäre ihr erspart geblieben. Diese wenigen Meter damals, die bis zur Oderbrücke fehlten, davon ist Eva-Maria Stege überzeugt. Damals, Anfang Februar 1945, befand sich das 16jährige Mädchen mit Eltern und Geschwistern auf der Flucht vor der anrückenden Roten Armee. Aus dem Dorf Grochow, 50 Kilometer östlich von Frankfurt/Oder, östliche Mark Brandenburg, hatte sich der Treck in Bewegung gesetzt. Alle hatten nur ein Ziel: über die Oder. Doch kurz vor jener Brücke kommandierten Männer der NSDAP- Kreisleitung alle ZivilistInnen ins nächste Dorf zurück, denn die Chaussee mußte frei bleiben für die abziehende Wehrmacht. In jenem Dorf wurde die 16jährige für immer aus ihrer bis dahin behüteten Kindheit gerissen. Denn nachts kamen die Russen und holten die Frauen. Eva-Maria wurde einem jungen betrunkenen Offizier „zugeteilt“. „Laß das, das macht doch alles schlimmer und nützt uns ja nichts“, wies ein älteres Dorfmädchen die weinende Eva-Maria zurecht, die sich entsetzt der brutalen Gewalt zu erwehren suchte.
Russen betrachteten Frauen als Freiwild
Die Sieger nahmen sich, was ihnen zuzustehen schien. Das Ausmaß der Massenvergewaltigungen durch Soldaten und Offiziere der Roten Armee auf ihrem Marsch nach Berlin sucht bis heute seinesgleichen. Hunderttausende, ja möglicherweise Millionen Frauen wurden in den Wochen und Tagen vor und nach Kriegsende zur Beute1. Ob Kinder oder Greisinnen: wie Freiwild wurden die Frauen, oft von mehreren Soldaten gemeinsam, in Kellern, im Treppenhaus, in ihren Wohnungen, auf der Straße, in den Flüchtlingstrecks, während der Zwangsarbeit überfallen. Immer wieder. „Nach dem zweihundertsten Mal habe ich aufgehört zu zählen“, vertraute eine Frau aus Ostpreußen Eva-Maria Stege an. Die Gewalt war alltäglich und öffentlich, geschah häufig vor den Augen der Ehemänner, Eltern, Kinder, Verwandten, NachbarInnen. Dennoch wurde dieses Thema bislang — aus Scham, aus politischer Opportunität — in der Geschichte verschwiegen oder höchstens als unvermeidliche Randerscheinung eines Krieges abgehandelt. Die kollektive Verdrängung überließ es den einzelnen Frauen, wie und ob sie dieses Trauma verwanden. Viele begingen Selbstmord, wurden dazu getrieben, von Ehemännern, Verlobten, Vätern und anderen Familienmitgliedern, die diese „Schande“ nicht verschmerzen konnten. „Erschieß mich“, bettelte Eva- Maria nach dem ersten Mal ihren Vater an. In den Nächten, die folgten, flüchtete sie in völlige Apathie, stellte sich tot, seelisch und körperlich. Das blieb lange Zeit so. Auch nach fast 50 Jahren kann Eva-Maria Stege nur mit Mühe über jene Erlebnisse sprechen. Aber sie zwingt sich.
Als Totengräberin endlos im Gulag
Die Vergewaltigungen waren nur der Anfang. Eva-Maria Stege geriet in das Heer der deutschen „Reparationsdeportierten“, jener ZivilistInnen aus den einstigen deutschen Ostgebieten, die zu Hunderttausenden vom sowjetischen Geheimdienst NKWD und der Roten Armee und mit Zustimmung der westlichen Alliierten zur „Wiedergutmachung“ und „Umerziehung“ in die Sowjetunion verschleppt wurden. Von Ende Januar bis Sommer 1945 wurden mindestens 200.000, vielleicht aber bis zu 500.000 Menschen östlich von Oder und Neiße oft willkürlich aufgegriffen — darunter viele Frauen und Minderjährige3. Mehr als die Hälfte starben namenlos bereits auf dem Transport, viele später in den Arbeitslagern überall in der Sowjetunion. Eva-Maria Stege überlebte — dank „meiner russischen Kassandra“. Eines Abends, am Anfang ihrer Gefangenschaft, stieß sie auf eine ältere Russin. Und diese prophezeite ihr folgendes Schicksal: „Mädchen, du bist eine Deutsche, und Stalin sieht in allen Deutschen seine Feinde. Er wird dich, wie alle seine Gegner, nach Sibirien bringen, für fünf, vielleicht aber auch für fünfundzwanzig Jahre. Wenn du zürückkehren willst, mußt du hart arbeiten, immer, auch unter den schwersten Bedingungen, vergiß das nie. Und noch eins: Du mußt Russisch lernen...“ Eva-Maria Stege kam für fünf endlose Jahre nach Sibirien. Sie lernte Russisch und sie arbeitete — unter härtesten Entbehrungen, zum Schluß nur noch 80 Pfund schwer: als Totengräberin und Schachtarbeiterin, als Maurerin, Stukkateurin, Traktoristin, Landarbeiterin, im Glühlampenwerk und in der Ziegelei, sie verlud Kohle und Schlacke, kutschierte Ochsenkarren und Pferdefuhrwerke, hütete Schweine. Und sie schippte Schnee, mit abgestorbenen Fingern und in nassen Filzstiefeln, bei dreißig, vierzig, fünfzig Grad minus. Sie büßte für die Verbrechen der Deutschen. Aber warum gerade sie? „Die Menschen starben nicht, sie verreckten“, an Auszehrung, Kälte, Krankheiten. Gut zwei Drittel der Menschen in ihrem Lager seien umgekommen, erzählt Eva- Maria Stege. 1.759 Tage dauerte dieser Alptraum, bis endlich das ersehnte „Skoro domoi“, „Bald nach nach Hause“, auch für sie galt. 1949, im Oktober, kam die Entlassung. Die DDR war gerade gegründet worden, und ein sowjetischer Offizier beglückwünschte die RückkehrerInnen: „Sie werden jetzt in einen neuen, demokratischen Staat kommen.“ An der Grenze in Frankfurt/Oder sagten die Rangierarbeiter: „Leute, bleibt bloß nicht hier in der Zone, geht nach drüben.“ Die 20jährige Eva-Maria aber wollte zu ihrer Familie, von der sie durch sporadische Briefwechsel in den letzten Jahren zumindest wußte, daß sie lebte. Verschlagen hatte es Eltern und Geschwister in ein Dorf nördlich von Berlin. Das Wiedersehen und die Eingewöhnung waren schwierig. Auch die Mutter hatte drei Jahre in einem Arbeitslager in Polen verbracht und war innerlich gebrochen. Gesprochen wurde über das erlebte Leid in der Familie nicht. Eva-Maria Stege verdrängte so gut sie konnte, wollte wieder zu Kräften kommen, blieb auch bewußt in der DDR, „weil da was Neues zu entstehen schien“. Ihre Erlebnisse als Kriegsbeute der „Befreier“ waren im neuen, demokratischen Deutschland kein Thema.
Eva-Maria Stege war kein Schweigegeld wert
Als sich einmal ein paar Kollegen über ihre Zeit in sowjetischer Kriegsgefangenschaft unterhielten und sie beiläufig sagte, daß auch sie Sibirien kenne, bekam sie zu hören: „Die Freunde haben keinen nach Sibirien gebracht, der nichts verbrochen hatte.“ Also schwieg sie, wie all diejenigen, die aus den stalinistischen Gulags in der DDR eintrafen. Doch anders als diejenigen, die in den dreißiger Jahren in der Sowjetunion als politische Gefangene inhaftiert, verbannt und nach Stalins Tod „rehabilitiert“ worden waren, erhielt Eva- Maria Stege niemals eine großzügige „Ehrenpension“ als Opfer des Faschismus oder als „Kämpfer gegen den Faschismus“. Dieses Schweigegeld war sie nicht wert. So lebt die heute 64jährige als Invalidenrentnerin von einer schmalen Rente, kämpft seit drei Jahren, seitdem sie zum ersten Mal über ihr Schicksal öffentlich geredet hat, um Wiedergutmachung für die stalinistischen Verbrechen. Von namhaften KünstlerInnen, SchriftstellerInnen, PolitikerInnen hat sie zwar Unterstützung erfahren, doch ohne Erfolg bisher. Denn im ersten, heftig kritisierten „Unrechtsbereinigungsgesetz“ (es passierte Mitte Juni den Bundestag, scheiterte aber am Freitag letzter Woche an der SPD-Mehrheit im Bundesrat; jetzt muß sich der Vermittlungssausschuß darum kümmern) tauchen Eva-Maria Stege und ihre LeidensgefährtInnen nicht auf. Schließlich sieht der Einigungsvertrag nur die Entschädigung derjenigen Zivildeportierten vor, die aus dem Gebiet der ehemaligen SBZ, das heißt der DDR, verschleppt wurden. Wer ein paar Meter oder Kilometer östlich von Oder oder Neiße geschnappt wurde, geht im neuen Gesetz leer aus und soll auch in einem zweiten nicht berücksichtigt werden. Für diese Gruppe, von der heute noch schätzungsweise 300 bis 1.000 in den neuen Bundesländern leben, kämpft Eva-Maria Stege im „Bund Stalinistisch Verfolgter“. Bis in höchste Regierungskreise wurde sie vorstellig, etwa bei Angela Merkel (CDU). Die aber speiste sie ab mit dem lapidaren Verweis, daß derzeit in Bonn an einem „Kriegsfolgenbereinigungsgesetz“ gearbeitet werde, in dem auch Inhaftierte und Deportierte aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten Berücksichtigung finden sollen. „Über die weiteren Entwicklungen informieren Sie sich bitte aus der Presse“ — mit freundlichem Gruß, Ihre Frauenministerin.
Öffentlich bleiben die Opfer stumm
Eva-Maria Stege kämpft gegen die Zeit, gegen die „biologische Lösung des Problems“. Denn die ältesten der Frauen, die sie betreut, sind heute 80 oder 90 Jahre alt — wie ihre Mutter um Beispiel. Für sie stellt sie Anträge auf Kriegsopferrente oder auf Unterstützung von der Stiftung für politische Häftlinge, ein bürokratischer Aufwand, den die meisten aus eigener Kenntnis oder Kraft alleine gar nicht bewältigen könnten. Dabei sind die alten Frauen dringend auf die paar tausend Mark angewiesen. Einige Betroffene haben sich inzwischen gemeldet, kommen in die Sprechstunde. Sie haben Vertrauen zu einer, die ihr Schicksal teilt, erzählten— manche zum ersten Mal — von der erlittenen Gewalt, Erlebnisse, die sie bislang nicht einmal dem Ehemann anvertraut haben. Aber öffentlich bleiben sie stumm. „Wer, wenn nicht ich, soll sprechen, wenn die anderen alle schweigen?“ macht Eva-Maria Stege sich Mut für diese Aufgabe. Seit Jahren ist sie mit ihren unheilbaren seelischen Wunden in psychotherapeutischer Behandlung. Doch jüngst hat sie einen neuen harten Schlag erhalten. Am Gründonnerstag konnte sie zum ersten Mal bei der Gauck-Behörde Einblick in ihre Akte nehmen.
Nach der Tortur spitzelte die Stasi
„Statt der Rente bekam ich die Stasi“, weiß sie heute. Denn von 1952 bis 1988 wurde sie fast lückenlos überwacht. Mehr als zehn Ordner war sie der Stasi wert. Im Mittelpunkt der Bespitzelungen stand seit den fünfziger Jahren der Verdacht, daß sie innerhalb der DDR „zentraler Stützpunkt“ für eine „kriminelle Menschenhandelbande“ sei, las sie dort fassungslos. 1954 wurde sie verhaftet. Eine Kollegin war wegen angeblicher Spionage festgenommen und zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Von ihr war Eva- Maria Stege schwer belastet worden. Nach 24 Stunden war sie zwar wieder frei, bekam aber Berlin-Verbot. So pendelte sie lange Jahre zwischen ihrem weit außerhalb gelegenen möblierten Zimmer und ihrem Arbeitsplatz. Ihren kleinen Sohn mußte sie zu ihren Eltern aufs Land geben. Doch beruflich ging es ihr zunächst nicht schlecht, sie bekam eine interessante Stelle im Außenhandel. Ihre „sibirische Vergangenheit“ aber begleitete sie in ihrer Kaderakte und drückte ihr das Siegel „politisch unzuverlässig“ auf. Zumal sie sich nie um Aufnahme in die SED bemühte. 1961 wurde ihr Bruder wegen versuchter Republikflucht zu 12 Monaten verurteilt. Die Konsequenzen für sie: Strafversetzung auf eine schlechter bezahlte Stelle. Eva-Maria Stege aber blieb auf unspektakuläre Weise widerständig. So weigerte sie sich 1968 als einzige in ihrem Betrieb, eine Resolution für den Einmarsch der Warschauer-Pakt- Truppen in die CSSR zu unterschreiben. 1978 versuchte ihr Bruder zum zweiten Mal die Flucht. Eva-Maria Stege knüpfte Kontakte zum Anwalt Vogel, der ihren Bruder nach einem Jahr Haft in die Bundesrepublik verkaufte. Sie war gewarnt worden: Sobald ihr Bruder die Staatsangehörigkeit abgesprochen bekäme, gäbe es für sie im Außenhandel kein Bleiben mehr. So geschah es. Sippenhaft: Kaum war ihr Bruder drüben, war Eva-Maria Stege draußen. Nach 26 Jahren mußte sie sich für monatlich 327 Mark für den Rest ihrer Arbeitszeit als Ankleiderin im Berliner Metropol-Theater verdingen. Neben der Gesundheit sind ihr durch diese Dequalifizierung rund 140.000 Mark an Verdienst und eine entsprechende Rente verlorengegangen. Eine Entschädigung hat sie dafür bis heute nicht bekommen. Wenn sie früher schon gewußt hätte, was sie seit April weiß, hätte sie sicher „längst Schluß gemacht“, sagt Eva-Maria Stege müde. Das Ausmaß der Bespitzelung und des Verrats im Friedenskreis Pankow, in dem sie seit Anfang der achtziger Jahre „so etwas wie eine politische Heimat“ gefunden hatte, berührt sie dabei noch am wenigsten. Fassungslos ist sie über das halbe Dutzend IMs, das sie in ihrem engsten FreundInnenkreis ausgemacht hat. Und da ist noch eine Beunruhigung: Es soll über sie eine Akte unter dem Namen „TV Bremse“ geben, die bislang unauffindbar ist. „Ich denke, mit Sibirien wäre ich irgendwie fertiggeworden“, sagt Eva-Maria Stege heute, „aber daß es dann fast nahtlos weiterging, hat mir den Rest gegeben.“ Sie sei nur froh, daß sie heute keinen Haß mehr spüre. Wohl aber sind die Alpträume zurückgekehrt: Sie steht mit vielen Frauen in einer Reihe. Ein sowjetischer Offizier befiehlt: „Hand aufmachen.“ Alle Frauen zeigen eine Plastikmarke vor, die meisten eine rote, nur ihre ist schwarz. Der Offizier sagt: Die schwarzen gehen nach Sibirien. „Warum immer wieder ich? Ich war doch schon dort!“ schreit Eva- Maria Stege verzweifelt. Davon wacht sie auf.
Sigrid Moser (Hrsg.): Bald nach Hause — Skoro damoi. Das Leben der Eva-Maria Stege. Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 1991
1Gerhard Reichling, Statistiker und Demograph, hat vor einiger Zeit die Zahl der deutschen Frauen und Mädchen geschätzt, die in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), den ehemaligen deutschen Ostgebieten sowie während der Flucht und Vertreibung vergewaltigt wurden. Nach seinen Schätzungen wurden 1,4 Mio. von Angehörigen der Roten Armee auf dem Vormarsch bis Berlin vergewaltigt, eine halbe Mio. in der späteren SBZ. Reichling ist z.Zt. Leiter der Deutschen Sektion der wissenschaftlichen Arbeitsstelle der Forschungsgesellschaft für das Weltflüchtlingsproblem und Autor zahlreicher Publikationen.
2Vgl.: Helke Sander, Barbara Johr (Hrsg.): „BeFreier und Befreite. Krieg, Vergewaltigungen, Kinder“. Kunstmann Verlag, München 1992. In jahrelangen Recherchen sind die beiden Herausgeberinnen dem Tabu der Massenvergewaltigungen in Deutschland in den letzten Kriegs- und ersten Nachkriegswochen nachgegangen, haben u.a. Hunderte Gespräche mit betroffenen Frauen geführt. Die Ergebnisse wurden jetzt in genannter Publikation und einem Film gleichen Titels veröffentlicht.
3Vgl.: Herbert Mitzka: „Zur Geschichte der Massendeportationen von Ostdeutschen in die Sowjetunion im Jahre 1945“. Sera Print Verlag, 3. Auflage 1989.
DDR-Knast Bautzen - Singen gegen die Selbstmordgedanken SPIEGEL, 31.10.2008
Misshandlungen, Schlafentzug, Scheinhinrichtungen: In keinem anderen Stasi-Gefängnis der DDR waren die Haftbedingungen so unmenschlich wie in Bautzen. Einziger Lichtblick war für viele Häftlinge der Knast-Chor, hier fanden sie Hoffnung - und konnten sich durch einen Trick auch vor Spitzeln schützen.
Sie waren jung und sagten, was sie dachten. Sie kritisierten Missstände, verteilten Flugblätter oder gaben verbotene Zeitschriften aus dem Westen weiter, damals Ende der vierziger und Anfang der fünfziger Jahre. Taten, die in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und in der gerade gegründeten DDR Grund genug waren, Menschen wegen Spionage oder "anti-sowjetischer Hetze" zu verhaften und zu verurteilen.
Einer von ihnen ist Oskar Stück. Er ist heute 83, aber er wirkt jünger. "Der Knast konserviert", sagt der Berliner und lacht. 1950 studierte Stück in Jena Deutsch und Französisch. Eines Morgens wurde er von zwei Stasi-Leuten aus dem Bett geholt und festgenommen. Den Grund erfuhr er zunächst nicht. Die beiden Geheimpolizisten fuhren ihn nach Weimar und übergaben ihn dem sowjetischen Geheimdienst NKWD, dem Vorläufer des KGB. Dort ließ man ihn nach einigen nächtlichen Verhören endlich wissen, warum er hier war - wegen "Antisowjethetze".
Stück hatte DDR-kritische Zeitschriften wie "Der Monat" oder "Die Tarantel" verteilt; eine vor ihm verhaftete Kommilitonin hatte nach nächtelangen Verhören seinen Namen genannt. Stück stritt die Vorwürfe zunächst ab, doch die Russen ließen nicht locker. Schließlich drohten sie, seine Frau zu verhaften, sollte er nicht gestehen. "Da hatte ich keine andere Wahl mehr", sagt Stück. Im Januar 1951 wurde der Student zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt.
Endstation "Gelbes Elend"
Ähnliches hat der heute 79-jährige Bodo Skrobek erlebt. Er wurde 1948 verhaftet, im Jahr vor der DDR-Gründung. Der Vorwurf gegen ihn: Mitgliedschaft in einer verbrecherischen, illegalen Organisation und Verbreitung antisowjetischer Hetzparolen. "Die Untersuchungshaft war das schlimmste", erinnert er sich. Vier Monate lang wurde er im Dessauer NKWD-Gefängnis in Einzelhaft festgehalten. Nach endlosen nächtlichen Verhören, Schlafentzug, Hunger, körperlichen Misshandlungen, zwei Scheinhinrichtungen und der Drohung, seine Eltern zu verhaften, unterschrieb der 19-Jährige schließlich ein seitenlanges Protokoll in russischer Sprache, das er gar nicht verstand. Im November 1948 wurde auch er zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt.
Stück und Skrobek sind zwei von etwa 35.000 Deutschen, die zwischen 1945 und 1954 von Sowjetischen Militärtribunalen in Geheimprozessen verurteilt wurden - in der Regel zu 25 Jahren "Besserungs-Arbeitslager". Für diejenigen, die nicht nach Sibirien verschickt wurde, hieß die Endstation oft Bautzen I - wegen der Klinkerfarbe der Gebäude im Volksmund "Gelbes Elend" genannt. Das Gefängnis war von 1945 bis 1950 sowjetisches Speziallager, in dem Männer jeden Alters und aus allen Gesellschaftsschichten eingesperrt waren, 17- wie 70-Jährige, Bauern und Professoren. So traf Bodo Skrobek in Bautzen den Pfarrer seines Heimatdorfs im Harz wieder. Er hatte in einer Predigt über das Zehnte Gebot die Bodenreform von 1949 als "organisierten Bandenraub" bezeichnet. Auch darauf standen 25 Jahre.
Viele überlebten das "Gelbe Elend" nicht, denn die Haftbedingungen waren unmenschlich. Allein bis 1950 starben etwa 3.000 Gefangene an Unterernährung, Tuberkulose und anderen Mangelkrankheiten. Sie wurden anonym in Massengräbern bestattet; bei Grabungen wurden 1992 die sterblichen Überreste von 180 Menschen gefunden. Viele Gefangene plagten während ihrer Zeit im "Gelben Elend" auch Selbstmordgedanken.
Halbnackt in der Zelle bei minus 15 Grad
Besonders gefürchtet war der Karzer. "Was das bedeutete, kann ein Außenstehender kaum nachvollziehen", erzählt Bodo Skrobek, der 14 Tage im Karzer vegetieren musste, weil er in der Zelle geraucht hatte. Entkleidet bis auf die Unterhose wurde Skrobek in die gerade 4 Quadratmeter kleine Karzerzelle geworfen. Der Ablauf sah so aus: Die ersten drei Tage gab es nichts zu essen, keine Kleidung und auch keinen Strohsack oder eine Decke zum Schlafen. Dann kam ein "guter" Tag, an dem man etwas bekam, danach wieder zwei schlechte ohne alles. "Das waren die schlimmsten Tage meiner gesamten Haft"", schaudert es Skrobek noch heute. Bei minus 15 Grad Celsius Außentemperatur hockte er halbnackt in der Zelle. "Nach zehn Tagen und Nächten hatte ich nur noch den Wunsch zu sterben." Nach den zwei Wochen Karzer konnte er weder gehen noch stehen; abgemagert bis auf die Knochen musste er in die Gemeinschaftszelle zurückgetragen werden.
Obwohl es in Bautzen eine große Anstaltskirche gab, waren Pfarrer oder Seelsorger dort lange unerwünscht. Als 1950 die DDR das Lager von den Sowjets übernahm, erlaubte sie Anstaltsgottesdienste und Gefangenenseelsorge, um den demokratischen Schein zu wahren. Als Anstaltspfarrer wurde der junge Pastor Hans-Joachim Mund eingesetzt. Er war ursprünglich religiöser Sozialist und besaß sowohl das Vertrauen der Partei - im Zentralkomitee der SED war er zuvor Referent für Kirchenfragen gewesen - als auch das der Kirche.
Von den Gefangenen erfuhr Mund bald, dass es in den Sälen, in denen bis zu 400 Gefangene untergebracht waren, illegale Chorgruppen gab. Und weil Mund seine Gottesdienste gerne festlicher gestalten wollte, setzte er bei der Anstaltsleitung durch, dass zwei dieser Saalchöre in seinen Gottesdiensten mitwirken durften - sein Dienstrang als Volkspolizei-Oberrat (Offizier) half ihm dabei. Bei seinen monatlichen Besuchen brachte er den Sängern Noten mit.
Vorsingen für Spitzel
Ab Sommer 1951 fanden etwa einmal im Monat evangelische und katholische Gottesdienste mit dem neuen Gefangenenchor statt. Die Häftlinge trieb nicht nur die Liebe zur Musik in das Ensemble - da die Chorknaben aus verschiedenen Gefängnissälen kamen, konnten sie sich bei den Proben austauschen und Kontakte knüpfen. Das war der Anstaltsleitung ein Dorn im Auge - und im November 1951 wurden die 48 Chormitglieder kurzerhand in eine Sammelzelle im Westflügel des Gelben Elends" verlegt. In der etwa 7 mal 10 Meter großen und 3 Meter hohen Gemeinschaftszelle gab es keine Toiletten, sondern lediglich zwei Holzkübel für die Notdurft. Geschlafen wurde auf doppelstöckigen Holzpritschen mit Strohsäcken - doch die Musik schweisste diese Männer zusammen und machten die widrigen Umstände erträglich.
Einer der beiden Chorleiter war der damals 23-jährige Detlef Nahmmacher. Er stammte aus einem gutbürgerlichen Elternhaus in Rostock und spielte mehrere Instrumente. Unter seiner Leitung probte der Chor täglich Choräle und Motetten, selbst geschriebene Sätze, später ganze Kantaten. "Die Motivation der Sänger war unglaublich", schwärmt Nahmmacher heute noch. "Wir waren ein sehr leistungsfähiger Chor." An kirchlichen Hochfesten wie Weihnachten oder Ostern habe der Bautzener Kirchenchor nicht selten in bis zu vier aufeinander folgenden Gottesdiensten gesungen. "Die Gottesdienste waren immer voll und wir hatten das Gefühl, etwas ganz Wichtiges zu tun."
Schnell wurde der Chor der Gefangenen zur verschworenen Gemeinschaft. Wenn Mitglieder ersetzt werden mussten, weil sie verlegt wurden oder durch Krankheit ausfielen, wurden neue Kandidaten genau unter die Lupe genommen - vor allem musste jeder Bewerber vorsingen. Bestand der Verdacht, dass es ein Spitzel sei, ließen die Choristen den Kandidaten immer schwierigere Intervalle singen, an denen er irgendwann scheiterte. "So konnten wir ihn nach ganz objektiven Kriterien abweisen", freut sich Nahmmacher noch heute. "Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir aufgrund dieser Praxis im gesamten Gelben Elend die einzige spitzelfreie Gruppe waren", ergänzt Ulrich Haase, der bei der Chorleitung half.
Gänsehaut beim Wiedersehen
Doch natürlich geriet der Chor mehr und mehr in das Visier von Stasi und Anstaltsleitung. Um die Chorknaben kleinzukriegen, mussten die singenden Gefangenen bald tagsüber in die "Produktion", Verweigerer kamen in Isolationshaft. Durch Amnestien kamen nach und nach einzelne Chormitglieder frei, zur Frustration der Zurückgebliebenen, denen nicht erklärt wurde, weshalb sie nicht entlassen wurden und wie lange sie noch bleiben müssten. Es kam nun auch häufiger zu internen Spannungen. Im März 1956 wurde der Chor wegen angeblicher illegaler Verbindungen von der Operativabteilung der Volkspolizei aufgelöst.
Die meisten Sänger aus der Gemeinschaftszelle gingen nach ihrer Entlassung in den Westen. Pfarrer Mund - längst im Visier der Stasi - floh, als er 1959 von seiner drohenden Verhaftung erfuhr. Er war bis 1982 Pfarrer der bayerischen Landeskirche. Ulrich Haase und Detlef Nahmmacher wurden Musiklehrer, Oskar Stück stieg zum Studiendirektor auf. Bodo Skrobek arbeitete zunächst als Bauleiter und ging später zum Bundesrechnungshof. Mittlerweile sind sie alle längst im Ruhestand.
Den Kontakt zueinander haben die Mitglieder dieses ungewöhnlichen Chors indes nie verloren. Seit 1958 treffen sie sich regelmäßig - der jüngste ist 77, der älteste 102. Und natürlich, wie könnte es anders sein, singen die "Bautzener Chorknaben" dann miteinander. 1994 feierten sie zum ersten Mal seit ihrer Entlassung wieder Gottesdienst in der Anstaltskirche in Bautzen - das bisher bewegendste Wiedersehen. "Als wir gemeinsam sangen 'Allein Gott in der Höh' sei Ehr' bekamen viele von uns eine Gänsehaut, denn wer hätte damals gedacht, dass wir an diesem Ort einmal wieder in Freiheit zusammenkommen würden", sagt Haase. "Das ist für viele von uns nach wie vor ein Wunder."
Aufstand in der DDR - Der Tag, an dem Stalin brannte SPIEGEL, 03.07.2013
Am 17. Juni 1953 wartete der zwölfjährige Peter Model in Halle an der Saale vergeblich auf die Straßenbahn. Mit einem Nachbarjungen machte er sich zu Fuß auf den Weg - bis ein unüberhörbares Klirren schlagartig Erinnerungen an das Ende des Krieges wachrief.
Als ich mir vor der Burg Giebichenstein die Zeit vertrieb, weil die Straßenbahn nicht kam, ahnte ich nicht, dass in der DDR gerade ein Volksaufstand ausgebrochen war. Und dass ich schon bald Unfassbares miterleben würde. Zwölf Jahre alt war ich damals, im Juni 1953. Neben mir saß auf einem Mauerstück ein Nachbarsjunge, den ich heimlich beneidete. Denn er wohnte im Innern der Burg, weil sein Vater dort Hausmeister war. Und die Mutter war Schaffnerin und hatte an dem Tag Dienst auf der Straßenbahnlinie 7 in Halle an der Saale. Vieles ging mir an dem warmen Sommertag durch den Kopf, als wir warteten und die Beine baumeln ließen. Bei Kriegsende im April 1945 waren hier die Amerikaner über die Saale gekommen. Die Kröllwitzer Brücke wurde im letzten Augenblick gesprengt. Fliegeralarm und Bombennächte lagen endlich hinter uns. Zum ersten Mal sah ich damals einen Schwarzen, in fremder Uniform. Wenige Wochen später folgten die russischen Soldaten, die kläglicher anzusehen waren. Sie saßen auf Fuhrwerken, die von mageren Pferden gezogen wurden, und schliefen auf Stroh. Panzer rollten durch die Straßen, dieses Mal kamen sie von Osten her. Die Eisenmonster sollten danach noch oft an meinem Fenster vorbeiklirren, meistens nachts.
Brodelnde Menschenmasse
Von der Straßenbahn war immer noch nichts zu sehen, obwohl sie nach der Turmuhr längst um die Kurve am Gasthof 'Zum Mohren' hätte biegen sollen. Wir entschlossen uns, der Mutter entgegenzulaufen, immer den Schienen nach. Lutherlinde - Museum - Reileck: Der vertraute Weg führte uns in Richtung Innenstadt. Plötzlich starrten wir gebannt die Ludwig-Wucherer-Straße hinauf und folgten nicht mehr den Schienen der Linie 7. Denn wie ein Lindwurm näherte sich eine brodelnde Menschenmasse aus Frauen und Männern. Staunend näherten wir uns und wurden von dem Strom mitgetrieben. Aus einem großen Gebäude im Paulusviertel wurden Fahnen aus den Fenstern geworfen. Papier wirbelte umher, eine Schreibmaschine flog auf das Pflaster. Zwei Autos wurden angezündet. Jeder Junge wusste, dass die dicken, schwarzen BMW-Limousinen 'Bonzenwagen' waren. In solch einem schönen Auto fuhr auch der Präsident der Republik! An dem Tag war aber alles anders. Wir beobachteten Schlägereien und sahen blutige Gesichter von Uniformierten. "Weiter!" hieß es im Befehlston. Die Menge strömte zum Reileck. Mitten auf der Kreuzung griff ein Mann zu einem Megaphon, das zur Ausrüstung eines Postens der Verkehrspolizei gehörte. "Auf, zum Roten Ochsen!" rief er. Das war das Gefängnis. Am Reileck waren zwei haushohe Porträts montiert, Öl auf Leinen. Stalin brannte nun, die Stofffetzen flatterten im Wind. Unglaublich! Als er März 1953 starb, mussten wir an der Schule noch Ehrenwache an der Gipsbüste des "Vaters aller Werktätigen" halten. Die Ausgabe der SED-Bezirkszeitung "Freiheit" erschien mit einem dicken Trauerrand, ebenso wie die Briefmarken. Und jetzt knüppelte die schreiende Menge sogar noch auf das andere Großbild ein, das Karl Marx zeigte. Nach hitzigen Diskussionen durfte dieses Gemälde aber schließlich hängen bleiben. "War doch ein Deutscher", wurde erregt erklärt.
Versteinerte Blicke
Bei den Fahnen des zuvor gestürmten Parteigebäudes hatte man es nicht so genau genommen, es brannten auch schwarz-rot-goldene. Russische Lastwagen fuhren heran, auf den offenen Ladeflächen standen Offiziere und deren Frauen mit Kopftüchern. Die Gesichter waren versteinert, ihre Blicke auf den brennenden Stalin werde ich nie vergessen. Auf einem Laster mit halleschem Kennzeichen erblickte ich junge Männer, von denen einige selbstbewusst ihre Arbeitskleidung mit Schweißerbrille trugen. Einen von ihnen erkannte ich genau. Mit G., etwa 18 Jahre alt, hatte ich drei Wochen in einem Ferienlager in Wettin verbracht. Wir hatten zusammen Ball gespielt und am Lagerfeuer gesessen und nun war er unter den Aufständischen! "Das sind unsere Kumpels von Leuna und Buna", hörte ich es um mich herum raunen. Keiner der Arbeiter war bewaffnet. Auf zum Roten Ochsen! Ein Transport-LKW ohne Aufbauten rammt rückwärts gegen das Tor vor dem alten Ziegelbau. "Aufmachen, aufmachen!" brüllten die Menschen. Die Gefängnisverwaltung hatte im Innenhof des Gefängnisses einen Polizei-LKW als Rammbock postiert. Ich hörte ein Krachen und berstendes Holz, dann ergoss sich ein schwacher Wasserstrahl über die Köpfe derjenigen, die gegen das Tor anrannten. Der Strahl wurde stärker, Steine flogen. Von links und rechts traten dunkelblau uniformierte Wärterpolizisten mit Karabinern in den Händen ängstlich aus der Einfahrt heraus. Auf einmal nahm ich aus der Ferne das altbekannte kalte Klirren von Panzern wahr. "Lauft weg! Weg hier, lauft!" wurde geschrien. Ich war schon längst allein, ohne den Nachbarsjungen, und floh mit anderen über Mauern und durch Gärten, bis ich zu Hause ankam. Auf dem Heimweg sah ich, wie Frauen an Bäckerläden für Brot anstanden. Ausnahmezustand! Die Alten erklärten uns, was das bedeutete: keine Versammlungen mit mehr als drei Personen, nächtliches Ausgehverbot, Schießbefehl. Noch jahrelang sollte dieser weiße Zettel an unserem Haus kleben. Unterschrieben war er von dem Stadtkommandanten der Roten Armee, dem wahren Herrscher in Halle. 1959, als ich das Abitur in der Tasche hatte, verließ ich dann die DDR.
DDR-VolksaufstandVom Schulhof ins
Mündungsfeuer
SPIEGEL, 13.06.2013
Eigentlich hatte sich Bodo Jung nur kurz vom Schulhof gestohlen, um die Demonstration zu bestaunen, plötzlich fand er sich zwischen Panzern und Maschinengewehrschüssen wieder. Am 17. Juni 1953 stolperte der 16-Jährige in einen Aufruhr, der Geschichte schrieb - und ihn in Lebensgefahr brachte.
Als ich mich am Morgen des 17. Juni 1953 auf den Schulweg machte, ahnte ich nicht, wie dieser Tag sich für immer in mein Gedächtnis einbrennen werden würde. Ich war 16 Jahre alt und in der 10. Klasse der Käthe-Kollwitz-Oberschule in Magdeburg. Nicht, dass ich völlig ahnungslos gewesen wäre: Von Demonstrationen in Ostberlin hatte ich schon über den Nordwestdeutschen Rundfunk, den wir regelmäßig zuhause hörten, erfahren. Aber hier in Magdeburg schien es ein Tag wie jeder andere. Wir hatten gerade Sportunterricht auf dem Schulhof, als plötzlich ein Schulkamerad rief: "Auf dem Breiten Weg wird demonstriert!" Der Breite Weg, eine Hauptstraße, verläuft in der Nähe der Schule. Ich wunderte mich: Sonst mussten wir doch stets von der Schule aus zu jeder Demonstration. Was war heute anders? Aufgeregt verließ ich den Schulhof und lief zum Breiten Weg. Ich staunte nicht schlecht: Überall drängten sich dort Demonstranten, es war gar kein Ende der Menschenmassen zu erkennen. Noch mehr wunderte mich allerdings, dass in der ganzen Menge kein einziges Transparent mit einer sozialistischen Losung zu sehen war. Erst jetzt begriff ich, dass dies kein linientreuer Auflauf war. Die Demonstranten protestierten gegen die bestehende Regierung. Fast alle waren Arbeiter aus dem Ernst-Thälmann-Werk und dem Karl-Liebknecht-Werk, die meisten noch in Arbeitskleidung. Ich überlegte nicht lange. Schnell zog ich mich um - schließlich hatte ich noch immer die Sportkleidung an - und schloss mich ihnen an.
Von der Polizei entdeckt
Es ging zum Gewerkschaftshaus am Ratswaageplatz. Vor dem Gebäude lagen jede Menge Akten, die einfach aus den Fenstern geworfen worden waren, und es flogen immer noch mehr. Das Haus war gestürmt worden. Ein Mann kam heraus, wahrscheinlich ein Funktionär der Gewerkschaft, und bekam Tritte und Schläge ab. Ein Passant ging dazwischen und mahnte: "Keine Gewalt!" Die Angreifer beruhigten sich wieder.
In meiner Nähe saßen Leute auf der Ladefläche eines Lastwagens. Sie riefen andere auf, sich dem Aufstand gegen die Regierung anzuschließen. Ich sprang fasziniert mit auf den Wagen, und ab ging es Richtung des Vororts Rothensee, wo große Betriebe standen. Hier wollten wir noch mehr Arbeiter für unsere Sache gewinnen.
Unterwegs legten wir einen Zwischenhalt ein: In der Neuen Neustadt ging es zur SED-Schule. Dort rissen wir, wie andere es inzwischen überall taten, alle sozialistischen Plakate herunter. Mir wurde ganz mulmig, als ein Polizist mich dabei beobachtete, der ganz in meiner Nähe wohnte. Doch der Polizist hat mich nie denunziert. Ich bin ihm noch heute dankbar.
Anschließend ging es weiter nach Rothensee, in einen größeren Betrieb. Die Arbeiter dort standen bereits alle auf dem Hof. Keiner von ihnen wusste richtig, was in der Stadt los war. Wir erklärten ihnen, was geschah, und forderten sie auf, uns zu folgen. Ich riss inzwischen alle Plakate ab, die ich so sah, auch, wenn ich dafür manchmal gefährlich hoch klettern musste.
Mittag bei Mutti statt Knastrevolte
Wir fuhren zurück in die Neue Neustadt, zum Gefängnis in der Umfassungsstraße, wo Politische inhaftiert waren. Beim Schlachter wurde eine große Fleischeraxt geholt und damit die Tür aufgehackt, um die Gefangenen zu befreien. Das wurde mir zu heiß. Ich setzte mich von der Gruppe ab und ging - ich wohnte ganz in der Nähe - erst einmal zum Mittagessen zu meiner Mutter.
Frisch gestärkt überlegte ich wenig später, was ich nun mit dem Rest des Tages anfangen sollte. Ich hatte noch Tatendrang, also machte ich mich auf den Weg zurück zum Gefängnis. Es schien, als hätte ich mit meiner Vorsicht Recht behalten: Vor der aufgebrochenen Eingangstür stand nun ein Russenpanzer. Der Platz vor dem Gebäude war wie leergefegt. Da hörte ich, in der Stadt sei noch was los - vor dem Polizeipräsidium, das zugleich ein Gefängnis war. Ich machte mich sofort auf den Weg, durch menschenleere Straßen.
Am Präsidium waren etwa 200 Leute, die offenbar daran gescheitert waren, das Gefängnis zu erstürmen. Und vor ihnen standen Panzer und russische Soldaten. Ich mischte mich unter die Leute. Immer wieder fuhren die schweren Kettenfahrzeuge mitten durch die Menge, die sofort zur Seite stob. Zum Glück wurde niemand überfahren, doch die schweren Panzer rissen Pflastersteine aus dem Boden los. Aus Frust hoben wir sie auf - und warfen damit nach ihnen.
Die Soldaten waren jung, vielleicht erst 18. Ihre Gewehre hatten Bajonette, aber ohne ihre Stahlhelme, nur in Käppis, machten sie irgendwie einen betretenen Eindruck. Ich kletterte zu einer Gruppe von Schaulustigen auf das flache Dach einer Baracke und sah mir die Sache von oben an. Unter meinem Arm hervor machte eine Frau Fotos. Mir war nicht ganz wohl dabei, weil nicht weit von uns die Soldaten standen. Wer wusste, wie die reagieren würden, wenn das alles fotografiert wurde? Später erfuhr ich, dass die Aufnahmen der Frau in Westberliner Zeitungen erschienen sein sollen.
Plötzlich lag er reglos da
Dann änderte die Situation sich dramatisch. Neue Soldaten kamen, Mongolen mit Stahlhelmen und vollständiger Gefechtsausrüstung. Noch nie hatte man diese Kämpfer bei uns in der Öffentlichkeit gesehen. Und nun standen sie vor uns - und stellten Panzerabwehrkanonen in unsere Richtung auf.
Augenblicklich kam Panik auf. Bloß weg von der Straße! Gemeinsam mit sechs anderen Jugendlichen kletterte ich zu den höher gelegenen Bahngleisen. Unter mir dröhnte ein Panzer. Der Turm drehte sich und das Maschinengewehr ratterte. Ich sah das Mündungsfeuer, dann ein Ehepaar auf der Straße. Plötzlich lag der Mann reglos neben seiner Frau, mit einem roten Fleck auf der Stirn.
Da rannten wir los, quer über die vielen Gleise der Hauptzuglinie nach Halle. Auf der anderen Seite sprangen wir auf niedrige Gebäude, die Garagen zu sein schienen. Zwischen den Dächern ein kleiner Zwischenraum, ich sprang darüber - und erstarrte vor Schreck. Unter mir kläfften und knurrten Schäferhunde. Das waren keine Garagen, sondern Hundezwinger! Und dazwischen standen Russen mit Gewehren in den Händen, die etwas in unsere Richtung riefen. Ich rannte wieder zurück auf die Gleise und rüber zu einer Gruppe von Häusern, die anderen hinter mir her. Wir kletterten unter das Dach des nächsten Hauses. Doch hier konnten wir nicht bleiben, wahrscheinlich wurden ja bereits nach uns gesucht.
Unerwartete Hilfe
Unsere Rettung kam unerwartet: Vor einem Haltesignal blieb ein Zug Richtung Hauptbahnhof stehen. Nichts wie hin und rein. Banges Warten, bis er endlich wieder losfuhr. Wenige Augenblicke waren wir endlich an der nächsten Haltestelle - allerdings ohne Fahrkarten. Damals gab es Sperren auf jedem Bahnhof, die man nur mit gültigem Fahrausweis passieren konnte. Was nun? Bei einer Kontrolle wären wir dran gewesen, man hätte sofort gewusst wo wir herkämen, und der Bahnhof war an allen Seiten abgesperrt. Wieder hatte ich Glück: Ein Zug Richtung Stendal fuhr ein, der über die Haltestelle Neustadt weiterfahren sollte - wo ich wohnte. Ich kletterte sofort hinein. Doch die anderen wollten nicht mit. Sie kamen aus anderen Gegenden von Magdeburg.
Die Reisenden ahnten zum Glück nicht, was hier vor sich gegangen war. Zufällig war mein Tanzlehrer im Abteil. Ihm fiel auf, dass ich mächtig aufgeregt war, und er erkundigte sich, was los sei. Ich erzählte alles. Ohne lange zu überlegen, gab er mir seine Fahrkarte. Dankbar stieg ich am Bahnhof Neustadt aus, den ich nun ohne Probleme verlassen konnte.
"Woher kommst Du?"
Endlich auf dem Weg nach Hause! Aber eine letzte Hürde wartete noch: In meiner Straße lag ja das gestürmte Gefängnis, und davor standen noch immer Panzer und Sowjet-Soldaten. Als ich passieren wollte, wurde ich natürlich angehalten. "Wo willst Du hin? Woher kommst du?" Ich erklärte, ich sei auf dem Weg von der Schule nach Hause und wohnte... tja... "in der Mitte der Straße" - wie hieß das noch auf Russisch? Verdammt, ich hatte doch fast eine Vier in Russisch bekommen. Also stammelte ich "ja jiwu na uglu" - "ich wohne an der Ecke". Sie ließen mich gehen. An der Ecke wurden meine Knie weich, ich musste weiter, aber ich dachte unentwegt an den Toten mit Kopfschuss. Ich versuchte, den Gedanken zu verdrängen und ging und ging - bis ich schließlich an meiner Haustür war. Nicht nur meine Mutter war heilfroh, dass ich noch am Leben war.
Am nächsten Tag kam ich zu spät zur Schule. Ich war eigentlich ohnehin nur gegangen, um meine Kumpels zu sehen, schließlich war ja klar, dass die Schule geschlossen sein würde nach allem, was passiert war. Doch sie war es nicht. Als ich den Klassenraum betrat, traf es mich wie der Schlag: Bis auf mich und noch einen, der das Gefängnis mit erstürmt hatte, saßen alle schon auf ihren Plätzen und schrieben... die schriftliche Russischarbeit!
Die Toten des 17. Juni 1953 - Abrechnung mit dem eigenen Volk SPIEGEL, 14.06.2013
Gewalt, Einschüchterung, Terror: Nur mit extremsten Mitteln gelang es der DDR-Staatsmacht im Juni 1953, den Volksaufstand niederzuschlagen. Tausende wurden inhaftiert, mehr als 50 Demonstranten starben. Doch die eigentliche Rache des SED-Apparats stand erst noch bevor. Von Christoph Gunkel
So viele Menschen hatte Ernst Jennrich noch nie auf den Straßen Magdeburgs angetroffen. Er wusste ja noch nicht einmal wie ein Streik aussieht. Und dann hieß es auch noch, vor der Haftanstalt Sudenburg und dem Polizeipräsidium würde geschossen. "Da hab ich zu meinem Sohn gesagt: 'Wir wollen da mal gucken'."
Es war der 17. Juni 1953, und in der DDR spielten sich auf einmal tumultartige, bis dahin völlig unvorstellbare Szenen ab, die so gar nicht in das Bild der straff durchorganisierten SED-Diktatur passten.
Als Ernst Jennrich mit seinem Sohn vor der Magdeburger Haftanstalt ankam, hatten die Demonstranten die Wachposten bereits entwaffnet, und Jennrich war plötzlich gefangen von der revolutionären Stimmung dieses Tages. Wenige Sekunden genügten, um das Leben des bis dahin unauffälligen Gärtners komplett aus der Bahn zu werfen: Der 42-Jährige entriss einem Halbwüchsigen einen Karabiner und gab damit zwei, wie er sagte, ungezielte Schüsse ab: einen in die Luft, den anderen auf die Mauer der Haftanstalt. Dann zerschlug er den Karabiner. Er habe mit seiner Aktion die Waffe entladen und weiteres Unheil vermeiden wollen, erklärte Jennrich später dem Gericht. Alles Lüge, sagte die Staatsanwaltschaft. Er habe gezielt auf einen Volkspolizisten geschossen und ihn getötet. Von "Mordhetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen" war die Rede.
Rache der Sieger
Bis Anfang Juli 1953 hatten Volkspolizei, Stasi und sowjetische Kommandos etwa 12.000 Menschen verhaftet, Jennrich war einer von ihnen. Sein Verhalten am 17. Juni bot der DDR Gelegenheit, zurückgewonnene Stärke zu beweisen: Die Stärke der vermeintlich unantastbaren SED-Diktatur, die vorübergehend ins Wanken geraten war. Im ganzen Land hatten Hunderttausende für Reformen, freie Wahlen, gerechte Löhne demonstriert - oder einfach ihrem generellen Unmut freien Lauf gelassen: Regierungsgebäude waren belagert, Gefängnisse gestürmt, Barrikaden errichtet worden. Die Staatsmacht hatte anfangs panisch und kopflos reagiert, in allen Großstädten den Ausnahmezustand verhängt und Hunderte Panzer geschickt. Steine flogen, Schüsse fielen: Es herrschte Anarchie in der DDR.
Doch so explosiv wie sich der Arbeiteraufstand entzündete hatte, so schnell brach er nach fünf Tagen unter dem massiven Einsatz von Polizei und Militär wieder zusammen. Der Sturz des Regimes blieb aus: Mitten im Kalten Krieg hatte es der Westen nicht wagen können, den Aufständischen zur Hilfe zu kommen. Nun begann die Rache der Sieger.
Im August 1953 wurde Ernst Jennrich zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe verurteilt. Das Gericht hatte ihm den angeblich gezielten Schuss nicht nachweisen können. Und doch erschien der harte Richterspruch einigen hohen Funktionären noch zu mild. Justizministerin Hilde Benjamin hatte schon vor Prozessbeginn interne Anweisungen gegeben, welche Strafe sie erwartete - und in ihrem Sinne ging die Staatsanwaltschaft nun gegen das Urteil in Berufung. Sechs Wochen später wurde Jennrich, der bis zum Schluss seine Unschuld beteuerte, in einem nur 15-minütigen Prozess von denselben Richtern wie beim ersten Prozess wegen Mordes zum Tode verurteilt. Einer der Schöffen legte daraufhin aus Gewissensgründen sein Amt nieder. Dem Gärtner Jennrich half dieser mutige Protest gegen die Willkürjustiz nichts: Am 20. März 1954 wurde er in Dresden enthauptet - Staatspräsident Wilhelm Pieck hatte sein Gnadengesuch abgelehnt.
Frühe "Fehler"
Das drakonische Urteil - 1991 wurde der Magdeburger posthum rehabilitiert - war auch Ausdruck der tiefen Verunsicherung, die der Aufstand bei den Regierenden hinterlassen hatte. Trotz der erfolgreichen Niederschlagung blieb der 17. Juni für die Herrschenden jahrzehntelang ein Trauma: "Ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht?", fragte Stasi-Chef Erich Mielke noch Ende August 1989 besorgt einen hohen Funktionär. Wenig später brach die DDR tatsächlich zusammen.
Die Verunsicherung 36 Jahre zuvor hatte allerdings nicht erst am 17. Juni 1953 begonnen, sondern drei Monate zuvor - mit dem Tod Stalins, der mit einer Wirtschaftskrise in der DDR zusammenfiel. Mangelnde Versorgung und Nahrungsmittelengpässe ließen die Flüchtlingszahlen immer weiter hochschnellen: Allein im März 1953 flohen 31.000 DDR-Bürger in den Westen. Die SED reagierte mit einer drastischen Erhöhung der Arbeitsnormen um zehn Prozent: Für denselben Lohn sollte fortan deutlich schneller und härter gearbeitet werden, um die ambitionierten Produktionsziele zu erreichen.
Gleichzeitig diktierte die neue Führung in Moskau der DDR hastig eine Reformpolitik, die die SED am 11. Juni 1953 derart übereilt veröffentlichte, dass sie damit selbst hohe Funktionäre überraschte und schockierte. Denn erstmals gab die Partei öffentlich "Fehler" zu, die zu der massenhaften "Republikflucht" geführt hätten. Steuererhöhungen und Zwangskollektivierungen von Betrieben sollten deshalb zurückgenommen werden, der private Mittelstand gefördert und das allgemeine Lebensniveau erhöht werden.
Doch die Zugeständnisse verfehlten ihre Wirkung: Viele DDR-Bürger fühlten sich nun ermuntert, erstmals das laut zu sagen, was sie vorher nur insgeheim gedacht hatten: Der Staat hatte größtenteils versagt. Hunderte traten aus der SED aus, und schon bald kursierten die wildesten Gerüchte: Staatspräsident Wilhelm Pieck? Auf der Flucht in der Schweiz angeschossen und verstorben! SED-Chef Walter Ulbricht? In Moskau verhaftet! Nein, bereits tot - Selbstmord.
Die Abrechnung
Die Gerüchte bestätigten sich zwar nicht, boten aber den passenden Nährboden für Proteste, Kundgebungen und Streiks, die schon in den Tagen vor dem 17. Juni landesweit ausbrachen. Überall verlangten die Demonstranten von der SED, die verhasste Erhöhung der Arbeitsnormen wieder zurückzunehmen. Doch schnell schlug die Forderung in eine generelle Abrechnung mit dem Staat um.
In Ost-Berlin brachte ein Arbeiter am 16. Juni die brodelnde Stimmung auf den Punkt, als er Bergbauminister Fritz Selbmann vom Rednertisch stieß, ihn als "Lump und Verräter" beschimpfte - und dann der jubelnden Menge zurief: "Wir wollen frei sein. Unsere Demonstration richtet sich nicht nur gegen die Normen. Das hier ist eine Volkserhebung. Wir fordern freie und geheime Wahlen!"
Am nächsten Tag wurde der Generalstreik ausgerufen und machte aus bis dahin lokalen Protesten einen Flächenbrand. Die Staatsmacht wusste sich nur noch mit den Reflexen der Diktatur zu helfen: Gewalt, Einschüchterung, Terror. Auch die sowjetischen Truppen beteiligten sich maßgeblich daran. Moskau ordnete schon am 17. Juni an, 18 Aufrührer standrechtlich zu erschießen. Ob das Ziel erreicht wurde, ist bis heute unklar. Nachgewiesen sind fünf Erschießungen durch sowjetische Kommandos und zwei Hinrichtungen auf Grund ostdeutscher Gerichtsurteile. Daneben starben mindestens noch 50 weitere Demonstranten durch Schüsse, Schläge und Misshandlungen; die genauen Opferzahlen sind bis heute nicht eindeutig zu rekonstruieren.
"Die Flamme löschen"
Mit großen Aushängen informierten die Behörden über die Hinrichtungen. "Die Plakate an den Litfasssäulen hatten einschüchternde Wirkung", schrieb Wladimir S. Semjonow, damals höchster sowjetischer Diplomat in der DDR, stolz in seinen Erinnerungen. "Es gelang uns, die Flamme zu löschen, bevor sie sich ausbreitete."
Zur Abschreckung war jedes Mittel recht. Der Furor des Staates traf selten die echten Rädelsführer. Sondern Menschen wie Alfred Diener, einen Schlosser, der am 17. Juni mit anderen Demonstranten in die SED-Kreisleitung in Jena eingedrungen war und dafür einen Tag später erschossen wurde. Systematisch machten die Behörden auch Jagd auf jene Häftlinge, die von den Aufständischen aus den erstürmten Gefängnissen entlassen worden waren. Von 1500 schafften es nur 63 in den Westen, der Rest wurde wieder kaserniert. Auf der anderen Seite versuchte die DDR seinen Bürgern auch Milde und Nachsicht zu suggerieren, indem sie Tausende der massenhaft Festgenommenen schnell wieder freiließ.
Repression, das merkte der Staat schnell, reichte allein nicht aus. Denn es galt ein Paradoxon zu erklären: Wie konnte es sein, dass Arbeiter und Bauern so massiv gegen einen Arbeiter- und Bauernstaat aufbegehrten? Es mussten also Schuldige von außen her. Der Staat fand sie in der Bundesrepublik, dem vermeintlichen noch durchgängig von Faschisten regierten ideologischen Feind. Schon bald deutete die DDR den Aufstand in einen aus dem kapitalistischen Westen gesteuerten "faschistischen Putschversuch" um. Das blieb die offizielle Lesart, die jedes Schulkind in der DDR lernte.
Nur: Beweise für diese breit angelegte Verschwörung waren nicht zu finden.
Dieser Mangel wurde im Juni 1954 vier Männern aus West-Berlin zum Verhängnis. Sie wurden allesamt entführt oder trickreich nach Ost-Berlin gelockt und dort festgenommen. Kurz vor dem ersten Jahrestag des Aufstandes wollte die DDR ihrer Bevölkerung einige Hintermänner der vermeintlich aus dem Westen gelenkten "Konterrevolution" präsentieren. In einem Schauprozess wurden die Männer zu Strafen zwischen fünf und 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nur einer von ihnen, der Polizeikommissar Werner Mangelsdorf, war aktiv an einem Streik am 17. Juni beteiligt gewesen.
Ein echter Revolutionär war aber auch der in Ungnade gefallene Polizeikommissar sicher nicht - er hatte sogar in West-Berlin als Stasi-Informant gearbeitet.
»Wir finden dich überall« aus DER SPIEGEL 34/1990, 19.03.1990
Von Mordplänen der Staatssicherheit war die frühere DDR-Staats- und Parteispitze informiert. Der einst allmächtige Geheimdienst unter Minister Erich Mielke traktierte vor allem Überläufer aus SED, Volksarmee und Stasi mit Attentatsdrohungen. Einige seien, berichten ostdeutsche Ex-Agenten, in die Tat umgesetzt worden.
DDR-Ministerpräsident Willi Stoph, heute 76, war fest entschlossen, ein geplantes Kapitalverbrechen seines Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) zu vereiteln. Weil er den eigenen Genossen jedoch nicht über den Weg traute, entschloß er sich zur Konspiration mit dem Westen. Durch einen Kurier ließ Stoph dem damaligen Staatssekretär im Bonner Ministerium für innerdeutsche Beziehungen, Dietrich Spangenberg, eine dringende Bitte übermitteln: Die Behörden sollten für größtmöglichen Schutz des DDR-Flüchtlings Werner Weinhold sorgen - ein MfS-Killerkommando sei unterwegs, den ehemaligen Soldaten der Nationalen Volksarmee (NVA) auf dem Boden der Bundesrepublik zu liquidieren. Stoph, heimlicher Kontrahent des damaligen SED-Generalsekretärs Erich Honecker, wurde noch konkreter: Weinhold, heute 41, der bei seiner Flucht 1975 die NVA-Männer Jürgen Lange, 20, und Klaus-Peter Seidel, 21, erschossen hatte, solle nach dem Stasi-Plan bei einem »inszenierten Unfall« ums Leben kommen. Mit der Mord-Aktion wolle das MfS potentielle Überläufer aus den Reihen der Grenztruppen abschrecken. Stophs vertrauliche Botschaft beweist, daß die frühere DDR-Spitze über geplante Kapitalverbrechen der Stasi informiert gewesen ist. Und der Inhalt seiner Warnung, vorige Woche durch Berichte des Bundesnachrichtendienstes (BND) um neue Details ergänzt, bestätigte die westdeutsche Abwehr in dem Verdacht, daß Erich Mielkes Stasi-Mannen auch in Zeiten der Entspannung das ganze Arsenal geheimdienstlicher Verrücktheiten parat hielten: gedungene Mörder, Unfallspezialisten, Giftmischer, Menschenräuber.
DDR-Flüchtlinge, die dem ostdeutschen Staat besonderen Schaden zugefügt hatten, wurden bis in die jüngste Zeit mit Morddrohungen traktiert. Noch 1988, gut ein Jahr vor der Wende, analysierte das Bundesamt für Verfassungsschutz in einem internen Vermerk die Gefährdung dieses Personenkreises: _____« Vielfach sind Drohungen bekannt geworden. Die Warnung » _____« vor einem tödlichen Verkehrsunfall wurde häufig » _____« verwendet. Oft hieß es: »Wir finden dich überall.« »
Solche Ankündigungen sollten vor allem politische Flüchtlinge, Überläufer aus NVA oder MfS und abtrünnige SED-Funktionäre einschüchtern, das Gefühl verbreiten, die langen Arme der Stasi-Krake reichten überallhin.
Ganz oben auf der Todesliste stand der Stasi-Oberleutnant Werner Stiller, der 1979 in den Westen geflohen war und durch umfassende Aussagen große Teile der DDR-Spionage lahmgelegt hatte. Stiller, der unter neuer Identität im Irgendwo abtauchte, ist nach seiner Flucht von einem DDR-Geheimgericht in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden, für seine Ergreifung wurde eine Million Mark ausgelobt. Hessens oberster Verfassungsschützer Günther Scheicher: »Wenn sie den Stiller gefunden hätten, dann hätten sie ihn sogar noch bis vor kurzem erschossen.«
Bei einer Chefrunde im MfS jedenfalls, erinnert sich ein ehemaliger Stasi-Oberst, habe Mielke mitten in einem seiner gefürchteten Monologe die Seinen unvermittelt gemahnt: »Es ist ja recht still geworden um Stiller.«
Auch auf Weinhold, lange Jahre Staatsfeind Nummer eins in der DDR-Propaganda, war eine Kopfprämie von einer Million Mark ausgesetzt. Der frühere NVA-Soldat war 1976 zunächst vom Essener Schwurgericht von der Anklage des zweifachen Totschlags freigesprochen worden, weil er bei der Erschießung der beiden DDR-Grenzer in Notwehr gehandelt habe.
Erst nach einem Veto des Bundesgerichtshofs und erneuter Verhandlung des Hagener Schwurgerichts wurde Weinhold 1978 zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt, die er zu zwei Dritteln verbüßen mußte - 1982 kam er frei.
Die Erfinder des Schießbefehls verfolgten ihn bis ins Gefängnis mit besonderem Haß. Er habe seine beiden Kameraden, so die DDR-Darstellung, »hinterrücks« ermordet. Noch 1981 sollte Weinhold, sagte ein ehemaliger Mitgefangener, aus der Gefängniszelle im sauerländischen Attendorn von der Stasi entführt werden. Der Zeuge gab an, er sei damals in die Bonner DDR-Vertretung gebeten und zur Mithilfe bei der Tat aufgefordert worden. Der Mann offenbarte sich jedoch westdeutschen Behörden.
Daß Mielkes Agenten wie der Filmheld James Bond mit einer »licence to kill« ausgerüstet gewesen seien, berichten nun auch Stasi-Überläufer, die seit der Wende beim BND auspacken. Die neuen Vorwürfe platzten - gezielt? - mitten in die innenpolitische Debatte über eine künftige Straffreiheit für alle Stasi-Mitarbeiter, die nicht an Gewaltverbrechen beteiligt waren.
Die BND-Spezialisten, aus deren Berichten vorige Woche diverse Springer-Zeitungen und die Illustrierte Bunte zitierten, wollen von mindestens zwei Stasi-Mordopfern wissen: *___Der DDR-weit bekannte Fußballspieler Lutz Eigendorf, ____der sich 1979 in den Westen abgesetzt hatte und im März ____1983 bei einem Autounfall ums Leben kam, sei in ____Wahrheit durch ein »Kontaktgift« getötet worden. *___Der 1971 aus DDR-Haft freigekaufte Michael ____Gartenschläger, 1976 bei der Demontage eines ____Selbstschußautomaten an der innerdeutschen Grenze ____getötet, sei von der Stasi in eine Falle gelockt ____worden.
Daß Gartenschläger, keine neue Erkenntnis, verpfiffen worden ist, haben westdeutsche Strafverfolger schon von Anfang an vermutet. Der Ex-Häftling hatte eine Gruppe von DDR-Gegnern um sich versammelt, die spektakulär von sich reden machte: Anfang 1976 montierten die Gartenschläger-Leute einen Todesschußautomaten, Typ SM 70, vom DDR-Grenzzaun ab und präsentierten das Gerät im SPIEGEL (16/1976).
Als Gartenschläger in der Nacht zum 1.Mai 1976, entgegen allen Warnungen, den Coup wiederholen wollte, wurde er an einem besonders bewachten Grenzabschnitt zwischen dem schleswig-holsteinischen Bröthen und dem mecklenburgischen Wendisch Lieps erschossen.
Gartenschläger-Freund Lothar Lienecke, bei der Aktion dabei, berichtete, es habe zuvor weder Warnruf noch Warnschuß gegeben. Joachim Böttcher, Leitender Oberstaatsanwalt in Lübeck, vorige Woche: »Der Tathergang ließ es schon damals als hochwahrscheinlich erscheinen, daß Leute auf Gartenschläger warteten.«
Der Verdacht erhärtete sich wenig später. In Gartenschlägers Gruppe hatten sich Leute eingeschlichen, die offenbar Kontakte zum MfS unterhielten.
Der eine, Gerd-Peter Riediger, wurde Ende 1976 vom Oberlandesgericht Schleswig wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten Haft verurteilt, bestritt aber, Gartenschläger verraten zu haben. Der andere, Udo Albrecht, ein schillernder Rechtsextremist mit zahlreichen Vorstrafen, entschwand 1981 bei einem Ortstermin unter den Augen westdeutscher Staatsanwälte durch ein Loch im Grenzzaun in die DDR - eskortiert von MPi-bewehrten Ost-Grenzern.
Handfeste Indizien für das mörderische Wirken der Stasi ließen sich bisher jedoch bei der Aufklärung, wie der Kicker Eigendorf zu Tode gekommen ist, nicht finden. Der Braunschweiger Staatsanwalt Hans-Jürgen Grasemann ist sicher: »Bei Eigendorf liegt die Sache ganz anders.«
Der Nationalspieler vom FC Dynamo Berlin, einem Stasi-Sportverein, war nach einem Freundschaftsspiel beim 1. FC Kaiserslautern in der Bundesrepublik geblieben. In einer unfallträchtigen Rechtskurve knallte er am 5.März 1983 um 23 Uhr im Braunschweiger Stadtteil Querum mit seinem geleasten Alfa Romeo GTV 6 an einen Baum, Eigendorf starb zwei Tage später. Eine Blutprobe bei Eigendorf, der in seinem damaligen Verein Eintracht Braunschweig wegen einer Verletzung auf der Reservebank gesessen und in seiner Stammkneipe »Cockpit« deprimiert ein paar Bier gezischt hatte, ergab 2,2 Promille.
Der Fall schien klar. Doch schon wenig später meldete sich der Spieler-Berater Holger Klemme mit der Information, auf den rechten Vorderreifen von Eigendorfs Wagen sei wahrscheinlich ein Schuß abgegeben worden. Andere wollten gehört haben, Eigendorf habe nach einem Schuß durch die Windschutzscheibe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Und schließlich ging ein anonymer Brief, Poststempel Hildesheim, bei Eintracht Braunschweig ein: _____« Ist Ihnen bekannt, daß die Gestapo der »DDR«, der » _____« Stasi, überall seine Finger im Spiel hat? Lassen Sie das » _____« Fahrzeug Ihres tödlich verunglückten L. Eigendorf genau » _____« untersuchen, vor allem die Bremsanlagen. Einer, der » _____« Bescheid weiß! XYZ. »
Denkbar ist, daß Stasi-Desinformanten mit solchen Gerüchten und anonymen Briefen den Eigendorf-Unfall erst nachträglich als eigene Aktion ausgeben wollten, um ihre Allgegenwart zu beweisen. Jedenfalls fanden weder die Experten des Wiesbadener Bundeskriminalamtes (BKA) noch Fachleute des Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungsvereins irgendeinen Anhaltspunkt für die Mordthese.
Die muß nun, nach den BND-Enthüllungen der vorigen Woche, neu überprüft werden - Behauptung eines Stasi-Überläufers: Ein »Kontaktgift«, auf die Türklinke des Eigendorf-Autos geschmiert, habe das Opfer zumindest betäubt und binnen zehn Minuten fahruntüchtig gemacht.
Diese Version, wie aus drittklassigen Agententhrillern abgekupfert, hält der BKA-Cheftoxikologe Klaus Rübsamen für »abenteuerlich«. Rübsamen, Spezialist für Schlangengifte und anderes exotisches Gefahrgut, kennt weder aus der Praxis noch aus der wissenschaftlichen Literatur einen einzigen Fall, in dem Gift, absorbiert durch die unversehrte Haut, binnen kurzer Zeit zur Ohnmacht oder zum Tod geführt hätte.
Die zahlreichen Giftmorde, mit denen sich Agenten gegenseitig aus dem Weg geräumt haben, folgten - soweit bekannt - einem anderen Muster. So kam 1978 in London der Exil-Bulgare Georgi Markoff auf merkwürdige Weise ums Leben. Ein Mann, wahrscheinlich ein bulgarischer Agent, hatte ihn mit einem Regenschirm angerempelt. Kurz danach spürte Markoff Schmerzen im rechten Oberschenkel, vier Tage später war er tot - vergiftet von einer winzigen Metallkugel, die aus dem Regenschirm abgefeuert worden war. Toxikologe Rübsamen, der damals für das BKA die Tat analysierte, ortete den Killerstoff: Ricin, das aus Rizinusöl gewonnen wird und noch giftiger wirkt als Blausäure.
Mit Blausäure getötet wurde 1959 in München der ukrainische Antikommunist Stefan Bandera. Der Agent des sowjetischen KGB, Bogdan Staschynski, hatte Bandera in einem Hausflur aufgelauert und ihm aus einer speziellen doppelrohrigen Sprühpistole das Gift, das aus zwei Glasampullen austrat, ins Gesicht geschossen.
Auch die Denkerhirne westlicher Geheimdienstler brachten im Agentenkrieg allerlei skurriles Mordgerät hervor. So stellte die amerikanische CIA 1975 eine Giftpfeilpistole vor, und der britische Geheimdienst erfand einen Giftpfeil-Bleistift. Doch immer mußte das Gift, zum Beispiel das aus der Rinde der Strychnos-Pflanze gewonnene Curare oder das aus dem Blauen Eisenhut destillierte Aconitin, dem Opfer unter die Haut, in Lunge oder Magen bugsiert werden.
Selbst dem italienischen Erfolgsautor Umberto Eco ist die Phantasie nicht ganz und gar durchgegangen. Einige der mittelalterlichen Mönche in seinem Seller »Der Name der Rose« kamen zwar durch Kontakt mit indizierten Aristoteles-Schriften um, die mit gestohlenem Gift aus der Stube des Bruders Botanikus präpariert waren: »Es hatte die Kraft von tausend Skorpionen.« Doch die Berührung des verbotenen Buches reichte nicht aus, die Opfer ins Jenseits zu befördern - sie hatten, zum Umblättern der Seiten, die Finger an der Zunge benetzt und sich auf diese Weise das Gift oral verabreicht.
Daß Eigendorf durch die Berührung eines Giftstoffs mit bloßer Hand betäubt wurde, hält auch der West-Berliner C-Waffen-Experte Professor Adolf-Henning Frucht, von 1967 bis 1977 in der DDR unter dem Vorwurf der »schweren Spionage und Gefährdung der Grundlagen der DDR« inhaftiert, für »unwahrscheinlich«. Für einen solchen Anschlag komme aus dem Todesarsenal der Militärs allenfalls das Nervengift VX in Frage.
Eine Absorption über die Haut berge jedoch »hohe Unsicherheit«, zudem zeige sich bei einer VX-Vergiftung ein anderes medizinisches Bild als bei Eigendorf. Ob das in Kaiserslautern bestattete Opfer exhumiert wird, steht noch nicht fest: Gutachter des gerichtsmedizinischen Institutes in Göttingen halten einen Giftnachweis kaum noch für möglich.
Sollte sich der Mordvorwurf aufgrund neuer Ermittlungen der Staatsanwälte bestätigen, müßten die Behörden auch andere ungeklärte Altfälle neu aufrollen. Im paranoiden Agentenmilieu haben sich immer wieder mysteriöse Todesfälle und Anschläge ereignet, die zu Spekulationen Anlaß gaben. Beispiele: *___Bernd Moldenhauer, Aktivist der antikommunistischen ____Gesellschaft für Menschenrechte, wurde 1980 auf einem ____Autobahnrastplatz bei Bad Hersfeld von seinem ____Vereinskameraden Aribert Freder mit einer Kordel ____erdrosselt. Freder, der nach seiner Verhaftung gestand, ____er habe »aus Habgier« gehandelt, hatte nach eigenen ____Angaben auch für Mielke gearbeitet - Mord im ____Stasi-Auftrag? *___Die Frau von Leonid Bassan, Ex-Oberstleutnant des ____bulgarischen Geheimdienstes und einstiger Oberassistent ____bei Professor Frucht im Ost-Berliner Institut für ____Arbeitsphysiologie, kam Ende der sechziger Jahre bei ____einem Autounfall nahe Frankfurt, ähnlich dem des ____Fußballspielers Eigendorf, ums Leben; Bassan selbst, ____der sich in den Westen abgesetzt und damals mit dem ____Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie über einen ____Job verhandelt hatte, schied eine Woche später durch ____Suizid aus dem Leben - Morde im Stasi-Auftrag? *___Kay Mierendorff, kommerzieller Fluchthelfer, wurde 1982 ____durch die Explosion einer Briefbombe, Format DIN A 5, ____in Bad Tölz schwer verletzt. Der Anschlag, so der ____westdeutsche Stasi-Experte Karl Wilhelm Fricke, sei ____"technisch perfekt« vorbereitet und ausgeführt worden - ____Mordversuch im Stasi-Auftrag? *___Uwe Harms, Geschäftsführer der traditionsreichen ____Hamburger Spedition Richard Ihle, an der die ____liechtensteinische DDR-Tochter Unisped zu 80 Prozent ____beteiligt war, wurde 1987 unter ungeklärten Umständen ____in Hamburg erschossen (SPIEGEL 47/1989) - Mord im ____Stasi-Auftrag? *___Hans-Ulrich Lenzlinger, der Fluchthelfer-König, wurde ____1979 in seinem Züricher Haus von Unbekannten erschossen ____- Mord im Stasi-Auftrag?
Für solche »nassen Sachen«, wie Mordaktionen im östlichen Geheimdienstjargon hießen, soll nach Erkenntnissen des BND die Stasi-Hauptabteilung I, Abteilung Äußere Abwehr, zuständig gewesen sein. Seit den sechziger Jahren bereits habe der BND »vage Informationen« über die tödlichen Agentenspiele besessen. Für »Gewaltmaßnahmen bis hin zum Mord« habe danach eine ganze »Bandbreite« von Möglichkeiten bestanden: _____« Einsatz von mit Gift präparierten »Genußmitteln« wie » _____« z. B. Zigaretten, Einsatz von Kontaktgiften, technische » _____« Manipulation an Kraftfahrzeugen, vorgetäuschte » _____« Selbstmorde, Entführungen/Verschleppungen, Auslobungen » _____« von Kopfgeldprämien. »
Menschenraub zum Beispiel gehörte bei KGB und Stasi zur traditionellen Arbeitsmethode. Allein zwischen 1945 und 1949 wurden, zunächst von den Sowjets, aus West-Berlin rund 600 Personen in den Osten verschleppt. Danach gab es weitere 295 Entführungen und 81 versuchte Kidnappings - die meisten unter Regie der damaligen Stasi-Abteilung 21 »Sicherheitsüberprüfung und Rückführungen«, Sitz Berlin-Johannisthal, Groß-Berliner Damm 101.
Die Zuständigkeit für spätere Mord- und Kidnapping-Pläne lag nach den neuen BND-Erkenntnissen direkt bei Minister Mielke sowie im Befehlsstrang des Generalleutnants und Vizeministers Gerhard Neiber. Der BND-Bericht: »Die Pläne für die jeweiligen Liquidierungen wurden nur in einem Exemplar handschriftlich erstellt und von Minister Mielke oder dessen Stellvertreter, General Neiber, persönlich abgezeichnet.«
Neiber wollte sich vorige Woche dem SPIEGEL gegenüber nicht äußern. Vor Vertrauten klagte er: »Wie soll man denn so ein Ding aus der Welt schaffen. Wozu soll ich denn nun erklären, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht gewußt?«
„Knabes Entlassung soll zeigen: jetzt ist Schluss mit der DDR-Aufarbeitung aus Perspektive der Opfer“
Publico-Gespräch mit Unionsfraktions-Vize Arnold Vaatz über den Machtkampf um die Berliner Stasi-Gedenkstätte
Von Alexander Wendt , 28.11.2018
Publico: Der von Linkspartei-Kultursenator Klaus Lederer und Kulturstaatsministerin Monika Grütters gefeuerte Direktor der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen Hubertus Knabe hatte sich vergangene Woche auf seinen Posten zurückgeklagt – was Lederer mit der Einsetzung eines neuen Direktors und anderen Maßnahmen zu durchkreuzen sucht. Wie beurteilen Sie diesen Gedenkstätten-Krieg?
Vaatz: Mit der Entlassung Knabes soll ein Enthauptungsschlag gegen die Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen geführt werden. Dazu ist offenbar jedes Mittel recht. Ich glaube aber, jetzt hat Herr Lederer überzogen. Es gibt ein so genanntes Maßregelungsverbot, das aus meiner Sicht ausschließt, jemanden, der gekündigt wurde, dafür zu bestrafen, dass er sich wehrt. Und das ist mit der sofortigen Kündigung von Knabe am vergangenen Sonntag geschehen. Neue Fakten, die ein solches Vorgehen rechtfertigen würden, liegen gegen ihn ja nicht vor.
Publico: Warum ist Hubertus Knabe eine solche Reizfigur?
Vaatz: Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Knabe hat in seiner Forschung die Unterwanderung der westlichen Linken durch die Staatssicherheit vor 1990 zum Thema gemacht. Er hat damit ein meinungsbildendes Milieu angegriffen, das zum unwissentlichen und teilweise sogar zum wissentlichen Verbündeten der DDR geworden war. Jetzt handelt eine große Koalition von Anwälten des DDR-Regimes wie Lederer und denjenigen im Westen, die den Mantel des Schweigens über ihre Nähe zur SED-Diktatur breiten wollen. Ihnen ist Knabe lästig. Daher hat die Stasiunterlangen-Beauftragte Marianne Birthler ihn schon vor 18 Jahren aus der Behörde entfernt.
Publico: Wie passt ihre Parteifreundin in dieses Bild, die Kulturstaatsministerin Monika Grütters?
Vaatz: Das weiß ich nicht. Wenn sie mit dem vermeintlichen Sprecher der DDR-Opfer Dieter Dombrowski einig ist, wähnt sie sich offenbar auf der sicheren Seite. Nur hat Dombrowski offenbar längst die Seiten gewechselt. Es scheint so, dass er in Brandenburg eine CDU-Koalition mit den Linken ansteuert. Ich bin gespannt, wie lange sich die Opferverbände von ihm noch an der Nase herumführen lassen. Andererseits ist Monika Grütters als Kulturministerin ein Stück weit auch auf das Wohlwollen genau des Milieus angewiesen, das ich gerade erwähnt habe. Ich halte aber ihre Haltung für korrigierbar.
Publico: Manche vermuten, dass sie bei der nächsten Wahl für die Berliner CDU mit dem Ziel antreten will, eine Koalition mit der Linkspartei zu schmieden.
Vaatz: Das ist Spekulation. Aber ein solcher Versuch würde die Partei vor eine Zerreißprobe stellen.
Publico: Soll mit der Entlassung Knabes etwas Grundsätzliches bezweckt werden?
Vaatz: Allen soll gezeigt werden, dass die umbenannte SED jetzt die Lufthoheit besitzt. Die Linkspartei ist zwar immer dabei, wenn es gilt, die Bundesrepublik zur materiellen Wiedergutmachung der DDR-Verbrechen in Anspruch zu nehmen, entzieht aber Schritt für Schritt den DDR-Opfern die Interpretationshoheit über ihre eigene Vergangenheit und ihr eigenes Schicksal. Die Entlassung Knabes soll demonstrieren: Jetzt ist Schluss mit der Aufarbeitung aus Perspektive der Opfer.
Publico: Aber ist dieser Vorwurf nicht unbegründet, da Herr Lederer sich ja nach eigenen Worten in keiner Weise in die Suche eines Nachfolgers einmischen will, sondern hier Ihrer Partei eine Schlüsselrolle zufällt?
Vaatz: Herr Lederer weiß, dass es für Knabe kaum gleichwertigen Ersatz gibt. Deshalb ist es sehr klug von ihm, sich herauszuhalten, um die zu erwartende Fehlbesetzung dann der CDU in die Schuhe zu schieben – und nebenbei die Kraft des verhassten Publikumsmagneten Hohenschönhausen schwinden zu sehen.
Publico: Ein Historiker hat Knabe vorgeworfen, er habe die Führungen von Besuchern durch die Ausstellung in Hohenschönhausen „manipulativ“ gestaltet. Was sagen Sie dazu?
Vaatz: Das ist infam von Herrn Kowalczuk. Ich hielt ihn immer für integer, aber man lernt dazu. In der Sache ist der Vorwurf unzutreffend. Wie dort die Dinge präsentiert werden, entschied der Beirat. Er beschloss ein Curriculum, nach dem verfahren wird. Wenn die Art der Führungen durch das ehemalige Stasi-Gefängnis manipulativ sein soll, dann kann man übrigens gleich alle Gedenkstätten schließen, egal welcher Art. In einer Gedenkstätte werden die Sachverhalte dargestellt, derer gedacht werden soll. Und natürlich stellt die Gedenkstätte die Geschichte aus Perspektive der Verfolgten und nicht den anstrengenden und entbehrungsreichen Arbeitsalltag des Wachpersonals dar. Was denn sonst?
Publico: Sollten Besucher auch nach dem zweiten Rauswurf Knabes noch in die Gedenkstätte kommen?
Vaatz: Freilich. Und die Gelegenheit nutzen, um ein Gespräch mit Frau Birthler zu fordern, die vom Stiftungsrat in der Affäre um Knabe zur so genannten Vertrauensperson berufen wurde, und sie fragen, inwieweit sie die einstweilige Vernichtung der wirtschaftlichen und beruflichen Existenz von Herrn Knabe mit manipulativ-denunziatorischen Methoden wegen der noch zu untersuchenden Verfehlungen seines Untergebenen für verhältnismäßig hält; ob sie ihre Berufung an die Gedenkstätten nicht aus Gründen der Befangenheit hätte ablehnen müssen.
Publico: Was erwarten Sie in dieser Affäre von Ihrer Parteifreundin Monika Grütters?
Vaatz: Ihre Zustimmung zu den Maßnahmen gegen Knabe zurückzuziehen. Sowohl die vom 25. September als auch die vom letzten Sonntag.
Arnold Vaatz, geboren 1955 in Weida, gehörte zu DDR-Zeiten zur Bürgerrechtsbewegung. Weil er den Reservedienst bei der NVA verweigerte, wurde er 1982 zu sechs Monaten Haft verurteilt, die er in der Strafanstalt Unterwellenborn verbüßte.
1989 gehörte der Mathematiker in Dresden zur „Gruppe der 20“, die sich aus der Protestbewegung gegen das SED-Regime bildete. Nach mehreren Stationen in der sächsischen Landesregierung wechselte Vaatz in den Bundestag.
Seit 2002 ist er stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion.
"Sonder- und Ehrenhaft" im "Dritten Reich"High Society im Goldenen Käfig
Von Katja Iken, SPIEGEL 17.03.2011
"Sonder- und Ehrenhaft" im "Dritten Reich"High Society im Goldenen Käfig
Zigaretten, Radio und eine Flasche Sekt am Tag: Den "Sonder- und Ehrenhäftlingen" der SS fehlte es an nichts - außer der eigenen Freiheit. Eingesperrt in Schlössern, Burgen und Nobelhotels fristeten berühmte NS-Gefangene im "Dritten Reich" ein luxuriöses Dasein.
Am grausamsten fand SS-Häftling André François-Poncet den teutonischen Eintopf. "Ich musste Zusammengekochtes essen", beklagte sich der einstige französische Botschafter in Berlin nach Kriegsende über seine Internierung. Ansonsten gab es wenig Grund zum Meckern. Während Millionen regulärer Häftlinge in den Konzentrationslagern gefoltert und ermordet wurden, war der Diplomat im mondänen Ifen-Hotel im Kleinwalsertal gefangen, wo er ausgedehnte Spaziergänge durch die österreichische Berglandschaft unternahm und Shakespeare, Rabelais und Nietzsche studierte. Sonntags ging François-Poncet mit Italiens Ex-Premier Francesco Saverio Nitti sowie den Prinzessinnen von Savoyen-Aosta in die Kirche, seinen "Volksempfänger" durfte er anschalten, wann immer ihn danach gelüstete. Der Ex-Botschafter hatte es gut getroffen, ebenso wie der Rest der im Ifen-Hotel Eingesperrten, allesamt Mitglieder der internationalen High Society. Sie gehörten zur privilegierten Schar der mehreren hundert "Sonder- und Ehrenhäftlinge" der SS: Politiker, Staatsrepräsentanten und Diplomaten aus den besetzten Gebieten ebenso wie in Ungnade gefallene deutsche Militärs, Geistliche, Industrielle und Adelige, denen der NS-Staat eine spezielle Fürsorge angedeihen ließ. Eingesperrt in beschlagnahmten Schlössern, Villen, Burgen, Hotels und Sanatorien, aber auch eigens errichteten KZ-Sonderhäusern, führten diese handverlesenen Feinde Adolf Hitlers als Geiseln des "Dritten Reichs" ein bisweilen luxuriöses Leben - oftmals nur wenige Meter entfernt von den Gaskammern und Krematorien. Dieses bislang wenig erforschte Thema der "Sonder- und Ehrenhaft" hat der Journalist und Historiker Volker Koop in einem neu erschienenen, sehr lesenswerten Buch aufgearbeitet.
Tischtennisplatte, Zither und Blumen im KZ
"Erziehungshäftlinge", "Vorbeugehäftlinge", "Protektoratshäftlinge" - oder eben "Sonder- und Ehrenhäftlinge": In ihrer menschenverachtenden Klassifizierungswut teilten die Nationalsozialisten ihre Feinde fein säuberlich in verschiedene Gruppen ein. Zur Kategorie der "Sonder- und Ehrenhäftlinge" zählten auch die "persönlichen Gefangenen des Führers": deutsche Regimegegner, die zu prominent waren, als dass man sie einfach ermorden wollte.
Der Geistliche Martin Niemöller etwa gehört dazu, aber auch Georg Elser: jener Mann, der am 8. November 1939 eine Bombe im Münchner Bürgerbräukeller deponiert hatte, um Adolf Hitler in die Luft zu sprengen. Dass die Nationalsozialisten den Hitler-Attentäter nicht sofort ermordeten, sondern zu Vorzugsbedingungen internierten, hatte einen einfachen Grund: Die NS-Führung plante, nach einem siegreichen Krieg einen Schauprozess vor dem Volksgerichtshof gegen Elser zu führen.
Innerhalb des KZ Sachsenhausen wurden eigens für den prominenten Führerfeind drei Zellen zusammengelegt, Elser bekam eine eigene Hobelbank eingerichtet, wo er sich als Tischler betätigen konnte und durfte seine Zither mit in die Haft nehmen. Ferner genoss er Sonderverpflegung, bekam ein Radio, einen mit Tischdecke und Blumen dekorierten Tisch und sogar eine Tischtennisplatte in sein Privatgefängnis gestellt, um laut Zeitzeugenaussagen mit der SS sportliche Wettkämpfe auszutragen. Erst als feststand, dass der Krieg endgültig verloren war, erschossen die Nazis Elser am 9. April im KZ Dachau: ein Schicksal, das den meisten anderen "Sonder- und Ehrenhäftlingen" erspart blieb, die bis auf wenige Ausnahmen überlebten.
Haft mit Hofstaat
Gerade für die ausländische Prominenz unter den Hitler-Gegnern, zum Teil als Faustpfand für spätere Verhandlungen vorgesehen, ging die Haft meist recht glimpflich aus. Besonders gut hatte es der belgische König Leopold III. getroffen. Er war nebst seiner Familie auf Schloss Laeken bei Brüssel und später auf dem sächsischen Schloss Hirschstein interniert und bekam von der SS sogar einen kleinen Hofstaat zugestanden. Auch sonst waren die Nazis bemüht, es der inhaftierten Majestät recht zu machen: Am 19. November 1940 empfing Hitler seine Königliche Majestät auf dem Obersalzberg, um ihn nach Sonderwünschen, einem größeren Schloss etwa, mehr Geld oder einer Gespielin zu fragen. Stattdessen bat der König um Erleichterungen für sein Land und die baldige Heimkehr belgischer Kriegsgefangener: Wünsche, die ihm Hitler allerdings nicht gewähren wollte.
Ansonsten mussten die "Sonder- und Ehrenhäftlinge" auf Annehmlichkeiten nicht verzichten, wie der SS-Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner nach dem Krieg vor dem Alliierten Militärtribunal in Nürnberg anmerkte: Die prominenten Gefangenen, etwa im Ifen-Hotel, aber auch im Rheinhotel Dreesen in Bad Godesberg, verbrachten die Haft, so Kaltenbrunner "bei dreifacher Diplomatenverpflegung, das ist die neunfache Nahrungsmittelzuteilung eines normalen Deutschen während des Krieges, bei täglicher Verabreichung einer Flasche Sekt, bei freier Korrespondenz mit der Familie."
Auch die auf Schloss Itter in Tirol untergebrachten "Ehrenhäftlinge", deren Namensliste sich wie ein Who is Who der französischen Elite liest, lebten im Vergleich mit den regulären KZ-Häftlingen in Saus und Braus: Die SS-Wachen wurden angehalten, ihren Gefangenen, unter ihnen der französische Ex-Premier Éduard Daladier, Gewerkschaftsführer Léon Jouhaux und General Maurice-Gustave Gamélin, "mit Stillstand und deutschem Gruß" zu begegnen.
Die illustren Häftlinge durften sonntags zur Messe, konnten die Haft gemeinsam mit dem Ehepartner verbringen und hatten es offensichtlich so kommod, dass sie gar nicht unbedingt flüchten wollten: Im Sommer 1944 entwickelten die auf Schloss Itter zur Zwangsarbeit verpflichteten regulären KZ-Häftlinge einen Fluchtplan, um sich gemeinsam mit den "Ehrenhäftlingen" in die Schweiz zu retten. Doch scheiterte die Flucht - weil sich die prominenten Gefangenen weigerten, den Plan in die Tat umzusetzen.
"In Sachsenhausen war es schöner!"
Mit am absurdesten mutet jedoch die "Ehrenhaft" des österreichischen Bundeskanzlers Kurt Schuschnigg an. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Österreich 1938 unter Arrest gestellt, bekam der inhaftierte Politiker so starke Depressionen, dass die Nazis einen Selbstmord fürchteten. Um dem vorzubeugen, ließ man dem prominenten Häftling eine besondere Fürsorge angedeihen: 1941 wurde Schuschnigg ins KZ Sachsenhausen verlegt, wo er in einem komfortablen Sonderhaus direkt neben der Todeszone wohnte.
Seine Frau Vera zog mitsamt Tochter Puppi freiwillig zu ihm, durfte das Gelände jedoch jederzeit verlassen. Ebenso wie Sohn Kurt, der mehrfach die Ferien bei seinem Vater im KZ verbrachte und von dort aus zeitweise jeden Morgen das örtliche Gymnasium besuchte. Eine eigens angewiesene - Schuschnigg allerdings nicht gut genug gekleidete Putzfrau - kümmerte sich um den Haushalt und sorgte für das leibliche Wohl, Konserven vom amerikanischen Roten Kreuz besserten die Kost noch weiter auf. Seine kleine Tochter fühlte sich im KZ Sachsenhausen so wohl, dass sie, als ihr Vater im Februar 1945 ins KZ Flossenbürg verlegt wurde, darum bat, zurück nach Sachsenhausen zu gehen. "Unser Kind aber fragt, ob wir nicht zurück nach Sachsenhausen könnten; 'denn dort war es schöner!'", zitiert Schuschnigg das Mädchen in seinen Erinnerungen.
Allerdings musste der österreichische Politiker, ebenso wie zahlreiche andere "Sonder- und Ehrenhäftlinge", für die Kosten seiner vergleichsweise noblen Internierung selbst aufkommen. Die Nationalsozialisten hatten sein gesamtes Vermögen beschlagnahmt, sogar der "Umzug" vom Gestapo-Gefängnis in München ins Konzentrationslager wurde Schuschnigg in Rechnung gestellt, Einmal in Sachsenhausen, erhielt der Österreicher vom Reichssicherheitshauptamt zwar ein monatliches Taschengeld, um sich zu verpflegen. Doch ging mehr als die Hälfte davon für den Schulbesuch seines Sohnes sowie die Lagerung seiner Möbel in Wien ab, wie der Historiker Koop recherchiert hat.
Promi-Gefangeneninsel à la Alcatraz
Je weiter der Krieg voranschritt, desto größer wurde der Bedarf an komfortablen Unterkünften für besondere NS-Gefangene, zu denen auch Politiker-Nachwuchs wie die Nichte Charles de Gaulles und der Sohn Stalins gehörten. Obwohl sich Deutschland in einer mehr und mehr ausweglosen Lage befand und es eigentlich dringlichere Probleme gegeben hätte, besaß man im NS-Staat immer noch Muße, sich detailliert mit der idealen Unterbringung der prominenten Gefangenen zu befassen. Nahezu jedes Schloss in Deutschland, Österreich, Polen und der besetzten Tschechoslowakei inspizierte die SS auf dessen Eignung als Luxus-Kerker. Beliebt waren vor allem auf Bergrücken gelegene Anwesen. Einst errichtet, um Angreifer aus dem Tal frühzeitig zu erkennen und abzuwehren, erschwerte die exponierte Lage nun den Ausbruch der Gefangenen.
Als perfekter Aufenthaltsort für ihre "Sonder- und Ehrenhäftlinge" erschien den Nationalsozialisten eine Insel: Fernab der Zivilisation sollten besonders wichtige Häftlinge isoliert und ohne jede Fluchtmöglichkeit untergebracht werden, als Vorbild diente das amerikanische Alcatraz. Mitarbeiter des Reichssicherheitshauptamtes schwärmten aus, um im Ostseeraum ein geeignetes Eiland zu finden. Im Sommer 1942 wurde man schließlich Suche fündig. Die Wahl fiel auf zwei dem estnischen Hafen Baltischport (heute Paldiski) vorgelagerte Inseln: Suur-Pakri und Väike-Pakri.
Sie seien "eisfrei, nur wenig bewohnt und vom Festland weit genug entfernt", pries der SD-Befehlshaber "Ostland" die Örtlichkeiten an. Doch sollte es nicht mehr zum Ausbau einer Gefangeneninsel am Finnischen Meerbusen kommen: Mit der Niederlage der deutschen Wehrmacht bei Stalingrad im Winter 1942/43 waren die Pakri-Inseln durch die Rote Armee bedroht - und damit für einen Promi-Kerker à la Alcatraz nicht mehr geeignet.
DDR-Gefängnisse: Mit Hunden und Peitschen gequält – WELT Von Jessica Caus, 10.06.2015
Heute lernen Kinder hier Verkehrsregeln: Sie fahren mit Rädern auf gepflasterten Wegen, üben rechts vor links und sicheres Überholen. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass an der Kreuzung von Barnim- und Weinstraße, wo jetzt die Jugendverkehrsschule des Berliner Bezirks Friedrichshain liegt, ein Gefängnis stand. Damals wurden hier Frauen gequält und sogar gefoltert. So wie eine junge Gefangene am 1. Februar 1951. Zwei Aufseher der DDR-Volkspolizei misshandelten sie schwer, trieben sie unter fortwährenden Schlägen vom Erdgeschoss des Gebäudes bis hinauf in den dritten Stock. Ihre Schmerzensschreie hallten durch die Gänge. Rund 350 andere Insassinnen hörten das Mädchen – und begannen, nach jahrelanger Peinigung, aufzubegehren. Eine der größten Häftlingsrevolten der DDR brach los. Die Gefangenen zertrümmerten die Fensterscheiben ihrer Zellen, demolierten Betten, Tische und Hocker, warfen ihr Essgeschirr durch die Gitter auf den Innenhof der Anstalt. Frauen, die gerade Hofgang hatten, randalierten ebenfalls. Die Wärter beendeten den Aufstand gewaltsam: Sie verprügelten die Frauen oder ließen ihre Wachhunde auf sie los. Anschließend ketteten sie einige besonders renitente Gefangene im Keller an und peitschten sie aus. Die Haftanstalt an der Barnimstraße war 1864 als Schuldgefängnis eröffnet worden. Beispielsweise für Menschen, die ihre Miete nicht zahlten oder nicht zahlen konnten. Die meisten Inhaftierten waren Männer. Doch schon vier Jahre später, 1868, wurde die Schuldhaft in Preußen abgeschafft. Nun nutzte man das Gebäude als Frauenhaftanstalt, für Untersuchungsgefangene oder Insassinnen mit kürzeren Freiheitsstrafen. Bis in die Weimarer Republik hinein machten Prostituierte den größten Teil der Häftlinge aus. Ihre Zahl ging etwas zurück, als 1927 durch das „Reichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten“ paradoxerweise einige Strafvorschriften gegen Prostitution gelockert wurden. Eingesperrt waren außerdem Mädchen und Frauen, die ihre Schwangerschaft abgebrochen hatten. Für Abtreibungen gab es bis zu zehn Jahre Haft.
Doch auch Schwangere, die ihr Kind austragen wollten, blieben nicht verschont, wenn sie kriminell geworden waren: Ihr Umstand bewahrte sie nicht vor dem Gefängnis. Eigens dafür richtete man in der Barnimstraße eine Mutter-Kind-Station ein. Frauen brachten dort ihre Babys zur Welt; nach der Stillzeit kamen sie ins Heim oder zu Verwandten.
Von Beginn an saßen in dem Backsteinbau auch politische Gefangene ein. Frauen war es gesetzlich verboten, in politischen Vereinen tätig zu sein – schon gar nicht in sozialdemokratischen oder sozialistischen. Wer sich dem widersetzte, wurde eingesperrt, so wie die wohl berühmteste Insassin der Haftanstalt: Rosa Luxemburg. Wegen Majestätsbeleidigung, Aufruf zum Klassenhass, Kriegsdienstverweigerung sowie Hoch- und Landesverrat saß sie in neun verschiedenen Gefängnissen, davon gleich zweimal in der Barnimstraße: 1907 und 1915/16. Für sie steht heute vor der Jugendverkehrsschule ein kleines Denkmal, eine Stele in der Form von Gitterstäben. Und nun wird auch die Erinnerung an das Gefängnis selbst, nach jahrzehntelangem Hin und Her, neu gestärkt – mit einer Audio-Inszenierung: Der Verkehrsplatz dient als Gedenkort, den die Besucher mit Kopfhörern abgehen. Sie bewegen sich durch die unsichtbaren Gänge der Gefängnistrakte und hören dabei die Lebens- und Leidenswege von fünf Frauen, die zu verschiedenen Zeiten in der Barnimstraße einsaßen.
Mit diesem Konzept hatte sich der Künstler Christoph Mayer bei einem Wettbewerb 2008 durchgesetzt. Drei noch lebende Zeitzeuginnen erzählen über Audio-Guides ihre Geschichte; die beiden anderen Frauen kommen mit Texten zu Wort, die der Drehbuchautor Thomas Wendrich verfasste und die Schauspielerinnen vortragen.
Auch das Schicksal einer Frau im Dritten Reich ist dabei: Sie hatte aus Protest Plakate überklebt und Flugblätter verteilt. Sie wurde verhaftet, wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“. Tatsächlich stieg seit der Machtergreifung Hitlers 1933 die Zahl der politischen Gefangenen stark an. Für etwa 300 Frauen, meist Widerstandskämpferinnen gegen den Nationalsozialismus, war die Barnimstraße nur eine Zwischenstation – auf ihrem Weg zur Hinrichtungsstätte Plötzensee oder zu den Frauen-KZs Moringen und Ravensbrück. Mussten die Inhaftierten vor dem Zweiten Weltkrieg nach damaligem Verständnis typische Aufgaben für Hausfrauen erledigen, etwa Kochen, Waschen und Nähen, wurden sie während des Krieges für die Rüstungsproduktion eingespannt. Wer sich wehrte, wurde von NSDAP-Aufseherinnen hart bestraft oder von der Gestapo gefoltert. Nach 1945 lag das Gebäude im sowjetischen Sektor Berlins. Es blieb unverändert in Benutzung, doch die Haftbedingungen verschlechterten sich noch einmal. Laut Berichten westlicher Zeitungen war das Gefängnis, auch wegen Nachkriegsdelikten wie Diebstahl und Schwarzhandel, überfüllt: Je 13 Frauen schliefen in einer Doppelzelle, zwei auf den Betten und die anderen elf am Boden auf Strohsäcken, die nur noch aus Häckseln bestanden. Läuse, Wanzen, Flöhe und auch Ratten breiteten sich aus. Doch nicht nur an Platz fehlte es. Jede Gefangene bekam lediglich ein Tuch, das sie entweder als Bettlaken oder als Decke verwenden konnte; Kissen gab es nicht. Auch die Kleidung wurde nur selten gewechselt, und die Rationen waren knapp. Es gab nicht genügend Toiletten, und die Heizung war defekt. Das Gebäude hatte im Krieg schwere Schäden davongetragen: Wenn es regnete, mussten ganze Zellenabteilungen geräumt werden und die Insassinnen noch enger zusammenrücken. Am 1. Februar 1951 übernahm die DDR-Volkspolizei die Leitung der Anstalt – auch das ein Grund für die Häftlingsrevolte am selben Tag. Denn Polizeirätin Scholz, die neue Chefin und Mitglied der SED, ordnete an, dass die Frauen ab sofort keine Lebensmittelpakete von Verwandten erhalten durften. Außerdem wurden die Gefangenen beim geringsten Anlass geschlagen oder mit Dunkelarrest bestraft. Viele DDR-Bürgerinnen kamen wegen Republikflucht, Passvergehens oder des Gummiparagrafen Boykotthetze in die Barnimstraße. Das Gefängnis füllte sich weiter: Artikel aus dem Jahr 1962 berichteten von bis zu 2200 Häftlingen. Auch weil zu dieser Zeit übergangsweise ebenfalls Männer eingesperrt waren. Laut westlichen Medien saßen sogar Kinder in dem heruntergekommenen Bau ein, vor allem Mädchen zwischen zehn und 15 Jahren: Sie mussten ihre strafffällig gewordenen Müttern in das Gefängnis begleiten und wurden nach einigen Wochen bis Monaten in Erziehungsheime gebracht oder zur Adoption freigegeben. Anfang der 1970er-Jahre verlegte das DDR-Innenministerium die Frauenhaftanstalt nach Berlin-Köpenick; das Gebäude in der Barnimstraße wurde 1974 gesprengt. Ein Neubauviertel mit Plattenwohnhäusern entstand; nach 1990 kam die Jugendverkehrsschule hinzu. Auf ihrem Areal kann man jetzt die Audioweg genannte virtuelle Gedenkstätte besuchen.
Entschädigung von DDR-Unrecht - Kaum Aussicht auf Gerechtigkeit
Von Niklas Ottersbach · 28.07.2022
In der DDR gab es rund 300.000 politische Gefangene. Sie wurden schikaniert und gequält. Noch heute leiden viele an körperlichen und psychischen Folgen, doch Anträge auf die Anerkennung von Haftfolgeschäden haben wenig Aussicht auf Erfolg. Das Beispiel Sachsen-Anhalt.
Die Stasi-Gedenkstätte „Roter Ochse“ in Halle. Michael Teupel steht in seinem ehemaligen Verhörraum. Ein kleines Zimmer mit grün gemusterten Wänden und einer Schreibmaschine. „Ich wache manchmal auf, erschrecke mich und höre Geräusche, wie wir sie jetzt von der Schreibmaschine hören“, berichtet er. „Und ich habe dann wieder Angstzustände, Flashbacks sagt man dazu. Das kriegt man auch nicht mehr weg. Das nehmen wir alle wahrscheinlich mit ins Grab.“
Über Ungarn ins blockfreie Jugoslawien
Mit „wir“ meint Michael Teupel die politischen Häftlinge in der DDR. Er selbst wollte mit 18 Jahren die DDR verlassen. Der Grund für ihn: die fehlende Reisefreiheit. Über Ungarn wollte er 1980 ins blockfreie Jugoslawien fliehen. „Und dann ist die Flucht misslungen, weil ich verraten worden bin.“ Für Michael Teupel ging es ins Stasi-Gefängnis in Halle. Ohne, dass ihm das jemand gesagt hätte. Er bekam dort eine Nummer, wurde isoliert. Nach einem halben Jahr im „Roten Ochsen“ wurde er ins Gefängnis in Brandenburg an der Havel verlegt. War es in Halle die psychische Zermürbung, kam in Brandenburg nun die physische dazu. Zwangsarbeit. Bei Wind und Wetter Güterwaggons zerlegen. Michael Teupel erinnert sich: „Ich war damals 18 Jahre, habe knapp 50 Kilo gewogen. Unterernährt eigentlich. Und musste dort körperliche Zwangsarbeit verrichten, ob ich wollte oder nicht.“ Einmal wollte er nicht. Im strömenden Regen sollte er die Anlage aufräumen. Teupel weigerte sich und kam zur Strafe in eine sogenannte Stehzelle: „Da waren sieben oder acht Häftlinge, die da standen wie die Heringe. Sie konnten auch gar nicht in Ohnmacht fallen, da wären Sie zu ihren Nachbarn gekippt. Sie standen halt einfach da, zehn Stunden ungefähr.“
Von der Bundesrepublik freigekauft
Insgesamt ein Jahr war Teupel in Haft. Dann wurde er wie so viele DDR-Flüchtlinge von der Bundesrepublik freigekauft. Kam in den Westen, nach Wetzlar. So richtig heimisch wurde er dort nie und kehrte Anfang der 2000er Jahre zurück nach Sachsen-Anhalt. Doch dann begannen die gesundheitlichen Probleme: Teupel bekam Schlafprobleme, eine Sozialphobie, Selbstmordgedanken. Erst als er über SED-Opferverbände erfuhr, dass es nicht nur ihm so geht, fasste er einen Entschluss: Er stellte einen Antrag auf Haftfolgeschäden beim Versorgungsamt Halle. Es begann ein zwölfjähriger Akten- und Gutachtenmarathon. Teupels Gerichtsakte war drei bis vier Mal so dick wie seine Stasi-Akte. Am Ende lehnte das Landessozialgericht seinen Antrag auf Haftfolgeschäden ab, er habe keine posttraumatische Belastungsstörung, hieß es. „Obwohl ich bis heute in Behandlung bin. Obwohl das ein Gutachter genauso definiert hatte. Ich habe das Gericht dann gefragt: Warum bin ich denn in Frührente, warum habe ich einen Schwergeschädigtenausweis?“ SED-Opfer Michael Teupel steht mit seiner Geschichte in Sachsen-Anhalt nicht allein da. In den vergangenen sieben Jahren, von 2015 bis 2021, konnte nur eine Betroffene ihren Antrag auf SED-Haftfolgeschäden geltend machen.
Nur wenige Anträge werden noch gestellt
„Ein Punkt ist natürlich mittlerweile, dass auch nur noch sehr wenige Anträge gestellt werden. Weil es sozusagen eine Aussichtslosigkeit beinhaltet. Das spricht sich ja auch herum.“ So interpretiert Birgit Neumann-Becker die Lage. Die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt erlebt in ihren Beratungen immer wieder, dass Gutachter aus den DDR-Haftakten zitieren und damit eine Ablehnung eines Antrags auf Haft-Folgeschäden begründen: „Das ist natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass man mit den Akten der Diktatur, mit der Sprache der Diktatur heute sagt: ‚Hier steht doch drin, es war alles okay, hier ist ja gar nichts weiter Auffälliges passiert, dann kann das ja nicht so schlimm gewesen sein.'“ Für die Entschädigung von SED-Opfern ist in Sachsen-Anhalt das Ministerium für Soziales zuständig. Ein Interview lehnt das Ministerium aus Termingründen ab. Schriftlich teilt stattdessen eine Sprecherin mit, dass die Zahl der Bewilligungen nichts über die Qualität der Begutachtungen aussage. Außerdem kämen in Sachsen-Anhalt in solchen Fällen nur medizinische Gutachter zum Einsatz, die Erfahrung im Umgang mit SED-Opfern hätten: „Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist festzustellen, dass bei vielen Anträgen der erforderliche ursächliche Zusammenhang zwischen Schädigung und geltend gemachtem Gesundheitsschaden eindeutig nicht vorlag.“
Ein dicker Aktenordner auf dem Schoß
Ein Garten im Magdeburger Südosten: Die 74-Jährige Sigrid Lustinetz sitzt auf der schattigen Veranda in der Julihitze, vor ihr ein dicker Aktenordner auf dem Schoß. „Das war am zweiten März 2022. In diesem Jahr erst“, sagt sie. Das Datum ist wichtig für sie. Denn am zweiten März hat ein Gericht anerkannt: Sigrid Lustinetz hat eine posttraumatische Belastungsstörung, bedingt durch ihre Zeit als politischer Häftling in der DDR. Dafür hat Lustinetz zwölf Jahre lang gekämpft: Gutachten, Untersuchungen, Gerichtsverhandlungen. Nun bekommt sie eine Opferentschädigungsrente in Höhe von 156 Euro pro Monat. „Obwohl meine Schwester immer gesagt hat: ‚Warum tust du dir das an? Für die paar Kröten, die du da kriegst.‘ Ich sage: ‚Monika, es geht mir doch nicht ums Geld, mir geht’s um mein Recht.'“ War es die Hartnäckigkeit, ein guter Anwalt oder doch Corona, warum ihr Antrag auf Haftfolgeschäden letztlich erfolgreich war? Sigrid Lustinetz weiß es nicht. Die Magdeburgerin musste 1987 ins Gefängnis. Der Grund: Sie hatte die gescheiterte Republikflucht ihres Neffen nicht angezeigt. Die Erzieherin kam zuerst ins Stasi-Gefängnis in Magdeburg und wurde danach nach Thüringen verlegt, nach Hohenleuben bei Gera.
„Für nichts haben sie mein Leben zerstört“
Auch Lustinetz musste Zwangsarbeit leisten. Ein halbes Jahr lang musste sie Taschentücher stanzen, unter anderem für westdeutsche Konzerne: „Acht Stunden stand ich an der Maschine, es war schlimm, es war die Hölle. Der einzigste Platz, wo man sitzen konnte, war auf der Toilette. Für nichts haben sie mein Leben zerstört.“ Sigrid Lustinetz leidet heute unter Bluthochdruck, Schlafstörungen, chronischen Reflux-Beschwerden. Langjährige Verfahren, immer älter werdende Betroffene: Die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke, will die Opferentschädigung jetzt vereinfachen. Statt Gutachten über Gutachten soll eine konkrete Vermutungsregel her, so wie es der Bundestag auch für Soldaten im Auslandseinsatz beschlossen hat: „Bei den Soldaten sind es Kampfhandlungen, die Bergung Verletzter. Und dann kommt eben die posttraumatische Belastungsstörung oder körperliche Erkrankungen. Wenn das eine oder das andere zutrifft, geht man davon aus, dass die Erkrankung davon kommt.“ Das Sozialministerium in Sachsen-Anhalt schreibt, möglicherweise könnte ein solches Verfahren die Versorgungsämter entlasten. Noch in diesem Jahr möchte Evelyn Zupke im Bundestag eine gesetzliche Regelung auf den Weg bringen. Michael Teupel dagegen glaubt, dass die aktuellen Rehabilitierungsgesetze gut genug seien. Es scheitere aber an der Durchsetzung. Für den ehemaligen Häftling und DDR-Zwangsarbeiter steht fest: Der Kampf vor Gericht hat ihn re-traumatisiert. Sein Antrag auf Anerkennung der Haftfolgeschäden sei ein großer Fehler gewesen. „Das waren zwölf Jahre, in denen ich körperlich, mental gelitten habe.“ Er könne keinem der ehemaligen politischen Häftlinge raten, in Sachsen-Anhalt einen Antrag zu stellen.
Vor 70 Jahren: Todesurteil gegen Hermann Flade in der DDR von DOMRADIO, 10.01.2021
Selbst Adenauer protestierte
Der Zweite Weltkrieg war kaum beendet, da zeichnete sich schon ein neuer Konflikt ab: Der Kalte Krieg zwischen West und Ost. Die Folgen bekamen unangepasste Menschen wie Hermann Flade am eigenen Leib zu spüren.
Mehr als 1.500 Menschen haben sich am Morgen des 10. Januar 1951 im erzgebirgischen Olbernhau versammelt. Nicht alle von ihnen sind freiwillig gekommen. Im Namen des Volkes der noch jungen DDR will das Landgericht Dresden vor 70 Jahren ein Exempel an einem "Mordagenten" statuieren. Lautsprecher übertragen die Verhandlung auf den Platz vor dem zum Bersten gefüllten Konzerthaus "Tivoli".
Vor dem Kadi steht der in Olbernhau aufgewachsene Oberschüler Hermann Flade. Sein Vergehen: Er hat in der Nacht vor den ersten Wahlen zur Volkskammer Flugzettel gegen den Urnengang verteilt. Die SED-Granden um Otto Grotewohl und Wilhelm Pieck hatten das im Vorfeld zugunsten der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) abgekartete Spiel als "Beitrag zur Erhaltung des Friedens" deklariert. Hermann Flade sieht das anders. "Die Gans latscht wie Pieck, schnattert wie Grotewohl und wird gerupft wie das deutsche Volk", steht auf einigen seiner Zettel.
Aktion läuft zunächst rund
Seine Nacht-und-Nebel-Aktion läuft zunächst nach Plan, auch wenn Flade sich später erinnert, wie aufgewühlt er innerlich war: "Ich musste gewaltsam das Zittern unterdrücken, das mich immer wieder befiel." Seit dem Februar 1950 baut die Staatssicherheit ihr Spitzelsystem aus, um "Agenten, Saboteure und Diversanten" zu bekämpfen. Auf "Boykotthetze" kann die Todesstrafe folgen.
Zur "Beruhigung" führt Flade ein Messer mit sich. "Die Uhr zeigte zwanzig nach zwölf. So spät schon, wunderte ich mich." Doch die restlichen 20, 30 Zettel will er nun auch noch loswerden. Da passiert es. Ein Volkspolizist und seine Kollegin halten Flade an, es kommt zu einem Handgemenge, der Schüler zückt panisch sein Messer und sticht mehrfach auf den Beamten ein.
Verletzer Beamte bleibt zurück
Der bleibt zusammen mit seiner Kollegin leicht verletzt zurück; Flade läuft im Zickzack um sein Leben. Und ahnt doch sehr bald, dass er sich in eine Sackgasse manövriert hat. "Ekel und Entsetzen" empfindet er vor sich selbst. Kurz darauf wird der 18-Jährige festgenommen.
Im "Tivoli" wollen die DDR-Oberen das Ganze nun propagandistisch ausschlachten, wie die Journalistin Karin König in ihrer soeben erschienenen Flade-Biografie schreibt. Doch der junge Angeklagte macht einen Strich durch diese Rechnung. "Die Freiheit war mir lieber als mein Leben", entgegnet er dem Richter, der ihn in die Enge treiben will.
Daraufhin werden die Lautsprecher, die das Geschehen nach draußen übertragen, abgeschaltet. Der Richter verurteilt Flade zum Tode - wegen "Boykotthetze", "militaristischer Propaganda" sowie "des versuchten Mordes und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte".
Richterspruch hat Konsequenzen
Die DDR-Justiz hat offenbar die Wirkung der Entscheidung unterschätzt. Im Großraum Dresden machen Parolen wie "Gebt Flade frei" oder "SED nieder" die Runde. Schwerer wiegt aber offensichtlich der Protest westlicher Spitzenpolitiker: von Berlins Regierendem Bürgermeister Ernst Reuter (SPD) bis hin zu Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU). "Ein Gebiet, in dem terroristische Handlungen wie dieser Urteilsspruch und andere Maßnahmen der letzten Tage möglich sind", habe mit einem demokratischen Gemeinwesen nichts zu tun, befindet der Kanzler.
Diese Einlassung zeige, wie weit sich Adenauer schon solidarisiere "mit faschistischen Methoden - wie sie sich in dem Verbrechen und der Erklärung Flades ausdrücken", tönt es postwendend aus dem DDR-Justizministerium zurück. Aber am 29. Januar 1951 wird das Todesurteil in eine 15-jährige Zuchthausstrafe umgewandelt.
Nach Haft Umzug in die Bundesrepublik
Für Flade folgt eine Odyssee durch einige der berüchtigtsten Haftanstalten der DDR, darunter das "Gelbe Elend" in Bautzen. Am 28. November 1960 wird er freigelassen. Noch im gleichen Jahr siedelt er in die Bundesrepublik über, wo seine Eltern bereits leben. Mit nur 48 stirbt er in Siegburg bei Bonn - möglicherweise an den Spätfolgen seiner Haft.
In ihrer akribisch recherchierten Biografie schildert König das katholische Umfeld, aus dem Flade stammte, ebenso wie seine Verpflichtung als geheimer Informant der Stasi 1958, mit der Flade vielleicht seine Haftzeit verkürzen wollte. Ihr Buch gerät damit zu einem packenden Stück deutsch-deutscher Geschichte, in dem es an Mut und persönlicher Tragik nicht fehlt.
Joachim Tschirner - Der DDR-Revolutionär war ein Stasi-Spitzel
Berliner Morgenpost, 4.11.2011, von Linda Wurster
Wenn es um die friedliche Revolution von 1989 geht, wird der Dokumentarfilmer Joachim Tschirner zu den Guten gezählt: Bei der großen Demonstration gegen das SED-Regime am 4. November 1989 auf dem Alex hielt er eine vielbeachtete Rede. Er war die Stimme der Revolution - tatsächlich aber war er ein Helfer des Regimes. Jahrelang spitzelte Tschirner für die Stasi.
Auf dem Alexanderplatz steht ein Lkw-Anhänger mit einem provisorisch zusammen gezimmerten Holzpodium darauf. Als ein Mann mit schwarzem Vollbart und großer Hornbrille auf das Podium klettert und ans Mikrofon tritt, weiß er vielleicht schon, dass er Teil einer ganz großen Sache ist. Wer sich dort hinstellt und über den verknöcherten Sozialismus und die SED-Diktatur spricht, gibt Hunderttausenden Menschen eine Stimme. Die Stimme der Revolution.
Es ist der 4. November 1989. Der Tag, an dem die SED-Führung erkennen muss, dass ihre Macht gebrochen ist. In der Innenstadt Ost-Berlins haben sich eine halbe Million Menschen versammelt. Am frühen Morgen sind sie über die Karl-Liebknecht-Straße zum Palast der Republik gezogen und von dort zum Alexanderplatz, zum Abschluss dieser Demonstration, die in die Geschichtsbücher eingehen wird. Das Oppositionsbündnis "Neues Forum" und Berliner Kulturschaffende hatten zu einer Kundgebung für die Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit aufgerufen. Gut einen Monat zuvor, am 40. Geburtstag der DDR, hatte das SED-Regime Demonstranten noch durch die Stadt gehetzt und niedergeschlagen. An diesem Tag aber schreitet niemand ein, um Transparente mit Parolen wie "Keine Lügen mehr", "SED - Nein danke" oder "Stasi in den Tagebau" zu beschlagnahmen. Das Volk übernimmt die Macht und das DDR-Fernsehen überträgt live. Auf dem Holzpodium sprechen die Bürgerrechtler Marianne Birthler und Jens Reich, der Schriftsteller Stefan Heym, der Regisseur Heiner Müller, die Schauspieler Ulrich Mühe und Jan Josef Liefers, 26 Redner insgesamt. Um 13.28 Uhr ist jener Mann mit Vollbart und Hornbrille dran: Joachim Tschirner, ein international bekannter Dokumentarfilmregisseur, damals 41 Jahre alt. Er wird fünf Minuten sprechen, sein Thema ist die Unfreiheit der Medien. Tschirner sagt: "Ich glaube nicht daran, dass eine wirkliche Wende möglich ist, solange die noch in den Chefetagen der Sendeanstalten und Redaktionen sitzen, die lediglich ihre Sessel um 180 Grad gedreht haben." Als Tschirner vom Mikrofon wegtritt, brandet Beifall auf.
Es ist die Rede seines Lebens. Das Foto von Tschirner am Mikrofon, im Anorak mit einem Zettel in der Hand, ist eines der Fotos dieses Tages, die sich ins kollektive Gedächtnis Deutschlands eingebrannt haben. Man findet es bei Wikipedia, in Geschichtsbüchern, im Bundesarchiv.
Eine Akte, rund 600 Seiten stark
Aus heutiger Sicht erscheint Tschirners Auftritt wie ein dreistes Schauspiel. Denn nach Recherchen der Berliner Morgenpost soll Tschirner 16 lange Jahre unter dem Decknamen "Hans Matusch" als Inoffizieller Mitarbeiter für die Staatssicherheit gespitzelt haben. Es gibt ein vom SED-Geheimdienst angelegte Akte, rund 660 Seiten stark, sie füllt drei dicke Bände. Diese Akte enthält Protokolle des Verrats an Kollegen, Bekannten und Freunden. Laut dieser Akte war Tschirner 25 und Student, als er sich am 8. Dezember 1973 zur Zusammenarbeit bereiterklärte, handschriftlich. Am 2. Oktober 1989, so besagen es Dokumente, soll er sich letztmals mit seinem Stasi-Führungsoffizier in der konspirativen Wohnung "Kaufmann" getroffen haben. Gut einen Monat vor seinem legendären Auftritt als Reformer auf dem Alexanderplatz also.
Tschirner, inzwischen 63, ist heute Geschäftsführer der Autorenvereinigung und Filmproduktion UM Welt Film mit Sitz am Hackeschen Markt in Berlin-Mitte. Tschirner, am Telefon auf seine Stasi-Verstrickung angesprochen, sagt: "Darüber müsste man in Ruhe reden." Und nein, er könne kein Versäumnis darin erkennen, dass er sich bislang nicht offenbart habe. "Ich bin nie darauf angesprochen worden." Er nehme diesen Teil seiner Biografie nicht auf die leichte Schulter. Allerdings habe er keine schriftlichen Berichte abgeliefert. Auf den Vorhalt, dass er laut seiner Akte mehrfach Menschen mit mündlichen Informationen in Bedrängnis gebracht habe, sagt er: "Das ist natürlich beschissen."
Der Inoffizielle Mitarbeiter "Hans Matusch"
Das Telefonat dauert gut eine halbe Stunde. Wenige Stunden später schreibt Tschirners Anwalt eine Mail, in der er rechtliche Schritte androht, falls über den Fall von IM "Hans Matusch" berichtet und sein Mandat namentlich genannt werde. Einen Katalog schriftlicher Fragen lässt der Anwalt unbeantwortet.
Man muss sich also an Tschirners Akte halten. Sie enthält tatsächlich keine handschriftlichen Berichte von ihm selbst, aber eine Vielzahl von detaillierten Protokollen: ständige Treffberichte mit Vorgesetzten etwa. Und, wenn es brisant ist: Welche Schritte die Stasi auf seine Informationen hin eingeleitet hat. Die Akte allein ist kein Beweis, allerdings nährt sie einen schwerwiegenden Verdacht.
Alles beginnt vor 38 Jahren.
Die Stasi interessiert sich für Tschirner, weil er in West-Berlin und im Ausland Studenten kennt, zu seinem Bekanntenkreis gehört der CDU-Nachwuchs, Mitglieder der "Jungen Union" in Kiel. Diese Kontakte will die Stasi nutzen.
Der erste Einsatz für die Stasi
Ost-Berlin, Sommer 1973. Tschirner soll bei den Weltfestspielen eine westdeutsche Delegation der Jungen Union "absichern", das war der Stasi-Jargon für Inschachhalten und Ausspionieren. Es soll - laut Akte - einer der ersten Einsätze Tschirners für die Stasi sein, ein paar Monate bevor er sich förmlich verpflichtet und IM "Matusch" wird. In den Unterlagen ist außerdem nachzulesen, dass Tschirner kurz vor seiner Verpflichtung die Umstände einer Republikflucht weitergegeben haben soll. Es geht um einen Kollegen beim DDR-Fernsehen. Der Fall erregt in der Stasi große Aufmerksamkeit. Sie ist mit dem Beginn der Zusammenarbeit offenbar mehr als zufrieden: "Besonders hervorzuheben ist seine Einsatzbereitschaft." So steht es in der Akte.
Für die Folgeaufträge sind Tschirners Bekanntschaften im "kapitalistischen Teil Deutschlands" wichtig. Die Stasi sucht Mitarbeiter im Land des Klassenfeinds, der BRD. Und sie will möglichst jede Flucht aus dem eigenen Staat verhindern, sie nennt das "Bekämpfung des staatsfeindlichen Menschenhandels". Tschirners Aufgabe soll es sein, Informationen zu sammeln und Verbindungen herzustellen. Laut Akte behilft er sich mit erfundenen Geschichten und mit falscher Identität, das MfS stellt ihm demnach sogar einen fiktiven Personalausweis aus. Als es bei der Kontaktsuche nach West-Berlin hakt, bieten ihm Mielkes Offiziere laut Akte einfach eine neue Hauptaufgabe: das DEFA-Dokumentarfilmstudio.
Einblicke in eine Nische des DDR-Fernsehens
Die DEFA ist ein volkseigenes Unternehmen der DDR. Tschirner war dort während des Studiums freier Mitarbeiter, später ist er Redakteur und Regisseur. Hier entstehen Filme, die das sozialistische Ideal transportieren sollen. Allerdings tummeln sich in der DEFA auch viele unangepasste Vertreter der Filmkunst, vor allem in der Abteilung Dokumentarfilm. Einige Macher haben sich über die Jahre hinweg kleine Freiräume geschaffen und können zunehmend kritischere Themen angehen.
Das Bild, das sich aus den Akten ergibt, wirft kein besonders vorteilhaftes Licht auf Tschirner. Demnach gewährt IM "Matusch" der Stasi ganz neue Einblicke in diese Nische des DDR-Fernsehens. In wechselnden konspirativen Wohnungen soll er sich regelmäßig mit Stasi-Leuten getroffen und über die Stimmung im Studio berichtet haben, über Projekte und Diskussionen unter Kollegen. Wie stehen die Mitarbeiter zur Abrüstung? Wie kommen von der SED lancierte Presseberichte an? IM "Matusch" geizt angeblich nicht mit harten Urteilen über Kollegen: Zwei bekannten DEFA-Filmern gehe es lediglich um ihren "Glorienschein" und darum "viel Geld zu machen"; sein ehemaliger Chef sei ein "Karrierist, der nur auf Prämien aus ist"; ein Mitarbeiter sei "als Mensch ein echtes Problem".
Besonders übel: Tschirner soll zwei Kolleginnen denunziert haben, die sich mit dem Gedanken tragen, die DDR zu verlassen. Er spricht sich dafür aus, ihre Ausreiseanträge abzulehnen. So jedenfalls hält es Tschirners Führungsoffizier in Treffberichten fest: Es erscheine "dem IM nicht zweckmäßig, wenn die Genannten eine Genehmigung zur Übersiedlung erhalten würden." Die Antragstellerinnen beschrieb der IM demzufolge als "derartig verbost und uneinsichtig, dass kein Argument für sie zugängig ist".
Auch hierzu ist von Tschirners Anwalt keine Stellungnahme zu erhalten.
Medaille "Für treue Dienste" in Bronze
1984 bekommt Tschirner von der Stasi die Medaille "Für treue Dienste" in Bronze. Auf der Urkunde steht Mielkes Unterschrift. Ein Jahr später fordert IM "Matusch" im Gespräch mit der Stasi mehr politische Einflussnahme auf die Filmemacher. Auch das hat sein Führungsoffizier in der Akte notiert.
Die Demonstranten, die sich am 4. November auf die Straße begeben haben, ahnen von all dem nichts. Als Tschirner auf die Bühne klettert, ist er der geachtete Dokumentarfilmer, ein unabhängiger Geist, ein Vertreter der Opposition. Wüssten die Demonstranten, dass sich hier ein Stasi-Spitzel als Revolutionär inszeniert, würden sie ihn vermutlich von der Bühne schleifen. Ein neues Selbstbewusstsein hat die Menge erfasst. "Stasi raus" skandieren sie. Trotzdem werden die Verfechter des alten Regimes nicht gejagt, sie dürfen sogar auf der Kundgebung reden: Ex-Spionagechef Markus Wolf etwa oder Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros. Bei ihnen allerdings wissen die Menschen, woran sie sind. Bei Joachim Tschirner ist das anders.
Fünf Minuten wird er reden, in der Hand einen Zettel, voll mit Stichpunkten. Er wird von seinen Dreharbeiten im bayerischen Auffanglager Grafenau berichten, das die Bundesrepublik 1989 errichtet hatte, um der gewaltigen Flüchtlingsströme aus der DDR Herr zu werden. "Das tiefe Misstrauen der Flüchtlinge uns gegenüber, als Vertreter der Medien, hängt mit ihren jahrzehntelangen Erfahrungen, mit dem Missbrauch der Medien in diesem Lande zusammen", sagt Tschirner. "Hattet ihr mit all dem nichts zu tun?" Es ist eine rhetorische Frage, gerichtet an die leitenden Kader, Chefredakteure und Kommentatoren. Nur er weiß, dass sie auch ihn selbst trifft. Ihn, IM "Matusch", ein gar nicht so kleines Rädchen in der Diktatur. Ihn, der mutmaßlich Fluchtwillige verpfiffen hat. Hier, vor großem Publikum, spricht er wie ein Ankläger über das Schicksal der Flüchtlinge in einem Lager und über ihre Furcht vor den SED-gelenkten Medien.
Berühmt ist Tschirner für seine aufwendige Langzeitdokumentation über Arbeiter im Thüringer Stahlwerk Maxhütte. Einige Teile des Filmzyklus drehte Tschirner zu DDR-Zeiten, andere im wiedervereinten Deutschland. Viel Lob hat er auch für seine Dokumentationen über Künstler erhalten: über den griechischen Komponisten Mikis Theodorakis etwa. In den vergangenen Jahren hat sich Tschirner vor allem mit Umweltproblemen wie dem Austrocknen des in Usbekistan und Kasachstan gelegenen Aralsees beschäftigt. Zuletzt präsentierte er den Film "Yellow Cake - Die Lüge von der sauberen Energie", einen Film über die Zerstörung der Natur durch den Uranbergbau.
Auftritt zum Jahrestag als Revolutionär
Einmal, im Jahr 1999, droht Tschirner aufzufliegen. Der Historiker Walter Süß, ein Mitarbeiter der Forschungsabteilung der Stasi-Unterlagen-Behörde, veröffentlicht ein Buch mit dem Titel "Staatssicherheit am Ende". Süß analysiert auch die Demonstration am 4. November 1989. Er erwähnt IM "Hans Matusch". Dessen Klarnamen aber kürzt er mit Joachim T. ab. Das ist nicht unbedingt üblich. Dass Tschirner bisher nicht enttarnt wurde, verdankt er nicht zuletzt einem Mitarbeiter des Stasi-Archivs.
Er kann sich nach wie vor mit seinem revolutionären Auftritt vor 22 Jahren schmücken.
Auch der 4. November 2009 bietet eine gute Gelegenheit, im Kino Babylon in Berlin-Mitte. Es ist der 20. Jahrestag der Demonstration am Alexanderplatz. Die Partei "Die Linke" lässt den bedeutenden Tag mit szenischen Lesungen, Vorträgen und Filmausschnitten noch einmal aufleben. Das Motto der Veranstaltung: "Eines langen Tages Reise ... Der Weg zur Demokratie". Man könnte auch sagen, die Linkspartei vereinnahmt den Tag für sich. Und Tschirner hat noch einmal einen großen Auftritt. Parteimitglieder und Sympathisanten feiern ihn. Auch der Tageszeitung "taz" sagt Tschirner damals, wie er sich 1989 gefühlt hat: "Als ich auf der Bühne stand, kam blitzartig die ganze Wut dieser Zeit in mir hoch."
Diese angebliche Wut hat am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz einen bemerkenswerten Satz hervorgebracht "Ich plädiere", sagt Tschirner, "für die Analyse von Vergangenem, und ich plädiere auch für die persönliche politische Konsequenz aus dem eigenen Versagen." Dieser Satz wurde oft zitiert, er ist Teil der Erinnerung an jenen Tag wie das Foto des Mannes mit dem dunklen Vollbart und der Hornbrille, der ihn ausgesprochen hat. Auch er erscheint plötzlich in einem ganz anderen Licht.
Claudia May ..... Offener Brief an Dieter Lauinger
An den
Thüringer Justizminister Dieter Lauinger,
Rechtsnachfolger des ehem.
Thüringer Justizministers Dr. Holger Poppenhäger,
jetzt amtierenden Thüringer Innenministers und
persönlichen Berater und Freund des
amtierenden Oberbürgermeisters Andreas Bausewein
der Landeshauptstadt Erfurt
15. Dezember 2014
Sehr geehrter Herr Minister,
im Koalitionsvertrag ist die „Aufarbeitung des DDR-Unrechts“, die Unterstützung und Hilfe für die Betroffenen verankert. Der Herr Ministerpräsident hat dieses Anliegen zur Chefsache erklärt.
Ihr Amtsvorgänger Herr Poppenhäger ist seit 1994 in wissentlicher Kenntnis der Fälschungen öffentlicher Urkunde Grundbuch „Erfurt, Am Stadtpark 34“gem. Stichtagsregelung: 18.10.1989 (BVerfGE, Az. 1 BvF 1/94) und der damit verbundenen rechtsstaatswidrigen Potenzierung des DDR-Nachfolge
- Die Thüringer Landesbeamtin - Claudia May - ist von Amts, Staats und Justiz wegen zur Sicherung des kriminellen Grundstücksverkehrs „Am Stadtpark 34“ und der sittenwidrigen Bereicherung des Täters: Stefan Lagler und seiner Erfüllungsgehilfen, Richterin am Thüringer Oberlandesgericht – Rita Pesta u.a. - zwangsweise - ohne Bezügeleistungen - in den Ruhestand versetzt worden.
Im Verfahren vor dem Landgericht Erfurt, Az. 9 O 1532/11, haben Sie - in persönlicher Verantwortung - die Haftanordnung gegen die amtseidverpflichtete Claudia May verfügt, weil sie die Wahrheit gem. § 60 ThürBG i.V.m. Art. 19 Abs. 4 und Art. 20 Abs. 3 GG öffentlich macht und u.a. den Täter: Stefan Lagler, Erfurt, Tschaikowski Straße 19 (Gerichtsgutachten der Staatsanwaltschaft vom 17.10.2003, Az. 180 Js 22533/03) und seine Erfüllungsgehilfen benennt.
Wann ordnen Sie als Weisungsberechtigter der Staatsanwaltschaft und Unterzeichner des am 5. Dezember 2014 in Kraft getretenen Koalitionsvertrages der Landesregierung die Strafverfolgungsmaßnahmen gegen den Täter: Stefan Lagler und seine Erfüllungsgehilfen, u.a. Richterin am Thüringer Oberlandesgericht Rita Pesta an? Sorgen Sie endlich für ein gesetzmäßiges und rechtskonformes Justizhandeln im Freistaat Thüringen, damit sich Deutschland an einem vorbildhaften Justizsystem orientieren kann und die Bürger, wie auch der amtierende Ministerpräsident vor den Intrigen und mutmaßlichen Rechtsbeugungen einer unkontrollierten und selbstherrlichen Richterschaft geschützt werden! Bolivien ist beispielgebend für eine unabdingbar notwendige und umfassende Justizreform, in allen Bundesländern des wiedervereinten Deutschland. Es ist einfach nur noch unerträglich, wie mit dem Souverän, einem demokratisch gewählten Staatsoberhaupt, dem Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringen Bodo Ramelow, umgegangen wird. Unrechts gegen die „Geschwister May“, anerkannte DDR-Verfolgte, DDR-Vermögensgeschädigte, DDR-Heimkinder, Schwerbehinderte und Thüringer Landesbeamtin, seit 2006 haftbewehrt durchgesetzt vom rechtsnachfolgenden Oberbürgermeister Andreas Bausewein .
„Die bösen Spielchen der Justiz“
Von Heribert Prantl
Rechtspflege ist ein schönes Wort für das, was die Justiz tun soll. Sehr unschön ist, was die Justiz in Dresden daraus macht. Sie nutzt die Paragrafen des Strafrechts, um den einst von der Bundesregierung geforderten „Aufstand der Anständigen“ einzuschüchtern. Die Sicherheitsbehörden sekkieren couragierte Leute, die sich Aufmärschen der Neonazis in den Weg stellen. Jahrelang geht das schon so. Da wurden die Handydaten von Gegendemonstranten erfasst, ihre Wohnungen durchsucht; da wird ermittelt wie wild und wie gegen nichts Gutes.
Zehntausend Menschen hatten sich 2010 dem alljährlichen Aufmarsch der Neonazis zum ersten Mal erfolgreich entgegengestellt. Einer von ihnen war Bodo Ramelow, der heutige Ministerpräsident. Die Justiz betreibt nun das eigentlich schon eingestellte Ermittlungsverfahren gegen ihn weiter, weil sie die Kosten des von ihr mutwillig inszenierten Verfahrens nicht tragen will. Deswegen hat sie erneut die Aufhebung der Immunität beantragt. Das ist nicht nur Posse, das ist Bosheit. Die Justiz setzt sich dem Verdacht aus, politische Spielchen zu treiben. Solche Spielchen lassen sich unter dem Begriff Rechtspflege nicht subsumieren.
Den Pfarrer Lothar König, der auch gegen die Neonazis demonstrierte, hat die Dresdner Justiz lange wegen Landfriedensbruchs verfolgt, bis endlich das Verfahren eingestellt wurde. Man fragt sich, wer da eigentlich den Landfrieden stört.“
Sehr geehrter Herr Dieter Lauinger,
ich erwarte, dass Sie als „neuer“ Ressortchef der Justiz des Freistaates Thüringen und Weisungsberechtigter der Staatsanwaltschaft unverzüglich handeln und die strafrechtlichen Ermittlungen im Fall der zwangsausgesiedelten „Geschwister May“ und ihres nach der Wende gewaltsam, haftbewehrt und „akut lebensbedrohend“ - ohne Gerichtstitel - zwangsenteigneten Erbgrundstücks „Am Stadtpark 34“ anordnen - ohne Ansehen der Person, um die seit 25 Jahren andauernden kriminellen Machenschaften der Erfurter Stadtverwaltung, insbesondere des Rechtsamtes, zu beenden. Die Sicherung des kriminellen Grundstücksverkehrs „Am Stadtpark 34“ und die Potenzierung des DDR-Nachfolge-Unrechts werden seit 25 Jahren aus öffentlichen Haushaltsmitteln voll finanziert - im Auftrag des ehem. Oberbürgermeisters Manfred Ruge und seines Rechtsnachfolgers, dem amtierenden Oberbürgermeister Andreas Bausewein.
Ordnen Sie die seit 25 Jahren überfälligen strafrechtlichen Ermittlungen - ohne Ansehen der Person - an und sorgen Sie für die Aufhebung der Immunität der daran beteiligten Verantwortlichen und Zuständigen. Meine uneingeschränkte Hilfe und Unterstützung bei der Aufklärung dieser kriminellen Machenschaften versichere ich Ihnen ausdrücklich.
Ihrer alsbaldigen Antwort und Aufhebung Ihrer Haftanordnung, Az. 9 O 1532/11, sehe ich entgegen.
Mit freundlichen Grüßen
Claudia May
Antikommunismus und Geschichtsrevisionismus DKP Schwerin 23. Juni 2014
„Lenin bleibt!“, sprühten Mitglieder der Schweriner SDAJ auf dem Platz vor der Lenin-Statue im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch. Gemeinsam mit Genossen der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), des RotFuchs, der PdL und weiteren parteilosen Linken protestierten sie am 17. Juni gegen eine „Kunstaktion“ eines hannoveraner Aktionskünstlers. Der ehemalige „politische Häftling“, Theologe und Antikommunist Alexander Bauersfeld plante, den Kopf der Statue symbolisch mit einem Bettlaken zu verhüllen. Mit seiner Aktion beabsichtigte Bauersfeld nicht nur den Kopf Lenins, sondern zugleich seine Ideen zu verhüllen. Er beabsichtigte, die Diskussion um den Abriss des Monumentes in der Landeshauptstadt erneut zu entfachen. Um seine Aussage noch zu bekräftigen, suchte sich Bauersfeld den 17. Juni aus, den er als Tag bezeichnete, „der wieder zu einem Feiertag in Deutschland werden solle“.
Dem entgegen stellten sich rund 30 Schwerinerinnen und Schweriner, die sich für „ihren“ Lenin aus unterschiedlichsten Gründen stark machten. Direkt vor dem Denkmal positionierten sich Genossen der SDAJ und DKP mit einem Transparent, das nicht nur das Konterfei des Revolutionärs zierte, sondern auf dem auch stand: „LIEBEN, LACHEN, LENIN LESEN!“. Rundum der Statue wurden Schilder aufgestellt mit Aufschriften wie: “Verhülle dich doch selbst!“. Die Anwesenden machten ihrem Unmut lautstark Luft, so dass von der Rede Bauersfelds nur Bruchstücke zu verstehen waren. Beleidigt und bepöbelt wurden sie dabei von Mitgliedern der FDP, AfD und „Menschenrechtlern“ die ebenfalls vor Ort waren. Obwohl die unterschiedlichen politischen Lager gemischt auf dem Platz standen, kam es zu keinen Handgreiflichkeiten.
Mit dieser Aktion wird nicht nur ein Angriff auf Lenin als historische Person verübt, sie ist gleichzeitig als Angriff auf die Ideen Lenins, auf die Leistungen der internationalen Arbeiterbewegung und den Marxismus/Leninismus insgesamt sowie als Verächtlichmachung der Lebensleistung vieler Bürger in der ehemaligen DDR zu werten. Die Bedeutung Lenins besteht nicht nur darin, dass er als Gründer der Sowjetunion, des ersten Arbeiter- und Bauernstaates, gilt, sondern dass er den Marxismus als Wissenschaft auf seine Zeit, die Zeit des Imperialismus, weiterentwickelte.
Der 17. Juni ist nicht der „Tag des Volksaufstandes“, wie Bauersfeld sagt, auch ist er kein Feiertag. Der 17. Juni ist der Tag der ersten versuchten Konterrevolution in der Deutschen Demokratischen Republik. Er wurde maßgeblich durch den Westen provoziert.
Die bronzene-Lenin Statue in Schwerin wurde 1985 aufgestellt. Sie stammt von Jaak Soans, einem estnischem Bildhauer. Die Skulptur wurde zur Erinnerung an das „Dekret über den Boden“ von 1917 aufgestellt und ist heute die westlichste Lenin-Statue in Europa.
Alexander Bauersfeld wurde 1948 in Nordhausen geboren. Er studierte Theologie in der DDR und wurde 1983 wegen landesverräterischer Nachrichtenübermittlung zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. 1984 wurde er von der BRD freigekauft und bezeichnet sich seitdem als „Menschenrechtler“ und als „Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft“. 2007 wurde er in Brasilien unter dem Verdacht festgenommen, kinderpornografische Bilder hergestellt zu haben.
25 Jahre BRDDR – Alexander Bauersfeld an der THS
Homberg. Der Ex-DDR-Bürgerrechtler Alexander Bauersfeld, Jahrgang 1948, aus Hannover hält am 3. Oktober, dem 25. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung, einen Vortrag in der Aula der THS. Er folgt damit einer Einladung der AG „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ unter der Leitung von Thomas Schattner an das Homberger Gymnasium. Bauersfeld erlernte zunächst den Beruf des Krankenpflegers in der DDR, dann studierte er Theologie ohne das Studium abzuschließen zu können. Als Student geriet er Mitte der 1970er Jahre aufgrund seiner kirchlichen Friedensarbeit in Konflikte mit dem DDR-Regime. So hörte das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) seit 1979 seine Telefongespräche ab, die er unter anderem mit Westberliner Fluchthelfern führte. Dazu Bauersfeld selbst: „Ich trug den Aufnäher „Schwerter zu Pflugscharen“, beteiligte mich an kirchlichen Aktionen, hatte West-Kontakte und verweigerte den Reservistenwehrdienst bei der Nationalen Volksarmee (NVA). Dazu stellte er einen Ausreiseantrag, weil Bauersfeld ab einem bestimmten Zeitpunkt wusste, dass er bespitzelt wird. Alles Gründe, um in der MfS-Sprache einen „Operativen Vorgang“ (OV) einzuleiten, der am 13. Januar 1983 zur Verhaftung wegen „Landesverräterischer Nachrichtenübermittlung“ (§ 99 StGB/DDR) führte. Das Ergebnis: 1983 wurde er in einem nichtöffentlichen Prozess vom Bezirksgericht Cottbus zu drei Jahren Haft verurteilt. Diese trat Bauersfeld in der Strafvollzugsanstalt Cottbus an. Die Begründung: Landesverräterische Nachrichtenübermittlung. „Die DDR-Justiz war eine Farce, der Prozess war doch schon vorher abgesprochen. Die Justiz war nur Erfüllungsgehilfe der Staatssicherheit“, so Bauersfeld.
Von seiner ebenfalls inhaftierten Ehefrau musste er sich während der Haft zwangsscheiden lassen. So entstand für Bauersfeld eine enorm schwierige Situation: „Nach meiner Scheidung wurde der Kontakt zu meiner Frau vom MfS unterbunden, meine Mutter wurde mit Verhaftung bedroht, wenn sie nicht über mein Schicksal schweigen würde. Verängstigt besuchte sie mich während meiner Haft, doch wichtige Nachrichten übermittelte sie mir nicht.“
Nichtsdestotrotz und gleichzeitig sehr mutig verhielt sich Bauersfeld vielleicht deshalb auch anders als andere Regimekritiker: „Ich habe ganz bewusst die Namen meiner Freunde und anderer Helfer genannt, weil es auch in der SED-Diktatur Zivilcourage gab“. Allerdings waren dies nur die Namen von Freunden, die schon in der Bundesrepublik lebten.
Kaum verwunderlich, dass Bauersfeld enorm unter den Haftbedingungen zuerst in einem Stasi-Gefängnis, dann in der Cottbusser Anstalt litt, schließlich wurde er auch in Einzelhaft gehalten. Das bedeutete, dass in den Zellen „kein Schreibzeug, keine Briefe, Fotos, Zeitschriften, kein Radio- oder Fernsehgerät“, gab. Und auch der Gefängnishof war nicht größer als die Zelle. „Es ging mir psychisch sehr schlecht, auch an Selbstmord dachte ich, in den Protokollen der Untersuchungshaftanstalt des MfS heißt es am 25. Juni 1983: „Der Beschuldigte gilt nach wie vor als Schwerpunkt. Er isst oft nicht und beteiligt sich kaum noch an den Gesprächen der Mitinsassen. Am 21. Juni 1983 sprach er mit seinem Mitinsassen Nummer 24/83 über die Möglichkeit des Selbstmordversuches.“ Was Bauersfeld nicht wusste, dass es schon Verhandlungen zwischen der BDR und DDR über seinen Freikauf gab.
Ein Jahr später, 1984, kaufte ihn die Bundesrepublik Deutschland für 95.000 Mark frei (ca. 47.500 Euro heute). Und das war auch gut so. „Vom MfS war er noch während der Haft in die Feindkategorie 4.1. eingestuft worden. Dahinter verbirgt sich die Anordnung: Freigabe zur Liquidierung im Krisenfall“. Als er von den Plänen erfuhr, dass er freigekauft werden sollte, konnte er es kaum noch erwarten. „Endlich, am 13. Juni 1984, erhielt ich die ‚Urkunde über die Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR‘. Mit diesem Dokument saß ich dann mit anderen in der Zelle, redete über ALDI und USA-Reisen, wir schliefen nicht in dieser letzten DDR-Knast-Nacht. Gegen Mittag wurden die Zellentüren geöffnet, wir kamen in einen Saal, dort wurden wir instruiert. Wir sollten auf den Herrn mit der Liste zugehen, unseren Namen mit Geburtsdatum nennen, dann über die Stahl-Feuerleiter zum Hof klettern und den Bus dort besteigen. In der Annahme, es wäre schon ein West-Anwalt, ging ich auf den Herrn zu und begrüßte ihn mit ‚Guten Tag‘, was ihn völlig irritierte, denn er suchte diesen Namen auf seiner Liste, bis er begriff.“ Dann konnte Bauersfeld in den Bus steigen, der ihn in die Freiheit bringen sollte. Kurze Zeit später erschien der Ost-Berliner Anwalt Vogel im Bus und formulierte eine kurze Ansprache: „Seien sie froh, dass sie in diesem Bus sitzen, die Karten dafür gibt es weder am Ostbahnhof noch am Kurfürstendamm.“ Von Vogel erfuhr Bauersfeld auch, dass es zuerst nach Gießen gehen sollte.
Seinen Freikauf am 14. Juni 1984 kommentierte Bauersfeld später ironisch wie folgt: „Für diese 95.000 Mark hätte die deutsche Bundesregierung auch etwas Vernünftiges kaufen können, beispielsweise einen Zwölfzylinder-Jaguar.“
Bauersfeld konnte nun in Freiheit leben, aber der Preis war hoch. Er musste ganz von vorn und neu beginnen und das vor dem Hintergrund, dass seine Ehe ganz bewusst zerstört worden war. „[…] die Stasi wollte mich auch loswerden, doch meine damalige Frau behalten. Sie war als Ärztin in der DDR zu wichtig und zu teuer, familiär durch ihren Bruder, einen Offizier der NVA (Nationale Volksarmee), für die DDR zu sehr gebunden, deshalb wurde unsere Ehe zerstört. In den Stasi-Akten fand ich Hinweise auf Überlegungen, schon vor unserer Haft die Ehe zu zersetzen, was letztlich erst nach unserer Inhaftierung mit brutalen Methoden gelang. Nach einem Vierteljahr zermürbender Untersuchungshaft beim MfS resignierte sie, stellte den Antrag auf Scheidung, die Staatsanwaltschaft stellte unter vielen Bedingungen das Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Sie musste ihren Wohnort sowie die Arbeitsstelle wechseln, der Kontakt zu bestimmten Kirchenvertretern wurde ihr verboten. Tragischerweise verunglückte später der sechsjährige Sohn tödlich, zur Beerdigung durfte ich trotz aller Bemühungen nicht in die DDR einreisen. Danach wollte sie die DDR auch verlassen.“ Zwar gelang es Bauersfeld später, seine geschiedene Frau in die Bundesrepublik zu holen. Am 18. April 1986 durfte sie ausreisen. Doch es folgte kein Happyend. „Wir trafen uns dann in West-Berlin, doch gab es für uns keinen gemeinsamen Weg mehr. Es war dem MfS gelungen, was es sich vorgenommen hatte: eine Familie zu zerstören“, so Bauersfeld rückblickend. Dennoch gelang es Bauersfeld sich eine neue Existenz aufzubauen, später arbeitete er als Pharmareferent.
Nach den Ereignissen im Herbst 1989 machte Bauersfeld durch zahlreiche politische Auftritte auf sich aufmerksam. Zentral dabei war immer der Umgang mit der DDR-Vergangenheit im wiedervereinten Deutschland. Als im August 2001 PDS-Mitglieder (aus der alten SED der DDR wurde zunächst die SED-PDS, dann nannte sich die Partei „Partei des Sozialismus“, heute nennt sich diese Partei „Die Linke“) aus Anlass des 40. Jahrestages des Mauerbaus Kränze für Opfer der Mauer niederlegen wollten, schritt Bauersfeld kurzerhand ein und entfernte die Kränze. Da eilten Polizisten herbei, stellten den bärtigen Störer. Bauersfeld sollte den Platz verlassen. Er ließ sich zu Boden fallen. „Ich gehe hier nicht weg. Wenn wir diskutieren wollen, können wir das vor der Kamera machen“, ruft er, so die „Welt“ im Jahr 2001. Und so kämpft er bis heute. Immer mit dem Ziel, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, wenn er politisches Unrecht entdeckt. Im Sommer 2014 kämpfte er zum Beispiel darum, dass am 17. Juni das Schweriner Lenin-Denkmal verhüllt werden durfte. „Seine Lenin-Verhüllung wollte die Stadt ihm verbieten, er musste bis vor das Landesverwaltungsgericht ziehen. Die Stadt hatte die Genehmigung zuvor abgelehnt. Eine Begründung: Teilnehmer könnten beim Hinaufklettern von der Leiter stürzen. Bauersfeld gewann.“ Alexander Bauersfeld hat sich des Weiteren in der Bundesrepublik „als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft ehemaliger politischer DDR-Häftlinge ‚Kirche von unten‘ einen Namen gemacht“, so die FAZ 2007. Er setzt sich gegen jede „Ostalgie“ im Hinblick auf die untergegangene DDR ein.
Und das wird er wohl auch bei seinem Vortrag in der Aula der THS am 3. Oktober um 15 Uhr. „Mein Anliegen ist, die Schüler zu informieren und ihnen zu zeigen, wie wichtig und richtig Zivilcourage ist, denn auch unsere freiheitliche Grundordnung ist immer bedroht, und deshalb politisch wach zu sein“, so wichtig ist. Er wird von „Lebenswegen von vielen mutigen Menschen“ berichten, die großen Einsatz für Freiheit und Demokratie gezeigt haben.
Quellenverzeichnis:
Alexander Bauersfeld, Bericht eines Betroffenen – Haft und Freikauf aus der DDR, in: Neue Züricher Zeitung vom 13. April 1989,
Alexander Bauersfeld, Freigekauft vor 20 Jahren, Rückschau eines Betroffenen, 2004,
http://www.kas.de/wf/doc/kas_5643-544-1-30.pdf, Stand: 13. September 2015, 15.40 Uhr,
Alexander Bauersfeld, Die Opfer der DDR-Diktatur sind noch immer benachteiligt, in: Neue Züricher Zeitung vom 25. September 2010,
Brief von Alexander Bauersfeld an Thomas Schattner vom 17. September 2015,
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18. Oktober 2007,
Die Welt vom 14. August 2001,
Die Zeit vom 30. August 2014.
(Thomas Schattner)
https://www.youtube.com/watch?v=9TresZO2q_w
Die Bilder vom 17. Juni stammen von der Landesbildstelle Berlin.

Leipzig. Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude diskutieren mit der Volkspolizei.

Volkserhebung in Leipzig.

Jena. Das Gefängnis nach der Befreiung der politischen Gefangenen.
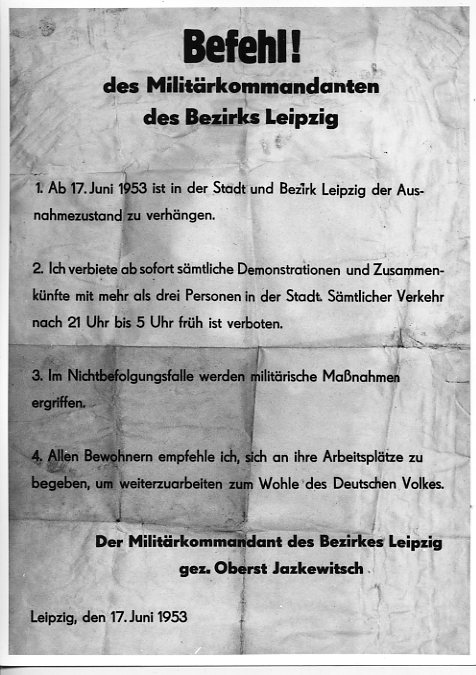
Erklärung des Ausnahmezustandes in der Stadt und im Bezirk Leipzig durch Befehl des Militärkommandanten.

Sowjetische Militäreinsätze am Potsdamer Platz/Leipziger Platz im Berliner Stadtbezirk Mitte.

Lockerung der Sektorenabsperrung, Anstehen vor der Ausgabestelle von Tagespassierscheinen in der Bernauer Straße, Wedding.

